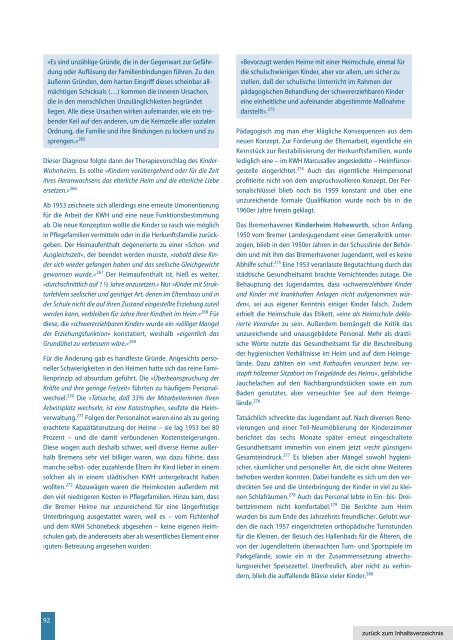1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
»Es sind unzählige Gründe, die in der Gegenwart zur Gefährdung<br />
oder Auflösung der Familienbindungen führen. Zu den<br />
äußeren Gründen, dem harten Eingriff dieses scheinbar allmächtigen<br />
Schicksals (…) kommen die inneren Ursachen,<br />
die in den menschlichen Unzulänglichkeiten begründet<br />
liegen. Alle diese Ursachen wirken aufeinander, wie ein treibender<br />
Keil auf den anderen, um die Keimzelle aller sozialen<br />
Ordnung, die Familie und ihre Bindungen zu lockern und zu<br />
sprengen.« 265<br />
Dieser Diagnose folgte dann der Therapievorschlag des Kinder-<br />
Wohnheims. Es sollte »Kindern vorübergehend oder für die Zeit<br />
ihres Heranwachsens das elterliche Heim und die elterliche Liebe<br />
ersetzen.« 266<br />
Ab 1953 zeichnete sich allerdings eine erneute Umorientierung<br />
für die Arbeit der KWH und eine neue Funktionsbestimmung<br />
ab. Die neue Konzeption wollte die Kinder so rasch wie möglich<br />
in Pflegefamilien vermitteln oder in die Herkunftsfamilie zurückgeben.<br />
Der Heimaufenthalt degenerierte zu einer »Schon- und<br />
Ausgleichszeit«, der beendet werden musste, »sobald diese Kinder<br />
sich wieder gefangen haben und das seelische Gleichgewicht<br />
gewonnen wurde.« 267 Der Heimaufenthalt ist, hieß es weiter,<br />
»durchschnittlich auf 1 ½ Jahre anzusetzen.« Nur »Kinder mit Strukturfehlern<br />
seelischer und geistiger Art, denen im Elternhaus und in<br />
der Schule nicht die auf ihren Zustand eingestellte Erziehung zuteil<br />
werden kann, verbleiben für Jahre ihrer Kindheit im Heim.« 268 Für<br />
diese, die »schwererziehbaren Kinder« wurde ein »völliger Mangel<br />
der Erziehungsfunktion« konstatiert, weshalb »eigentlich das<br />
Grundübel zu verbessern wäre.« 269<br />
Für die Änderung gab es handfeste Gründe. Angesichts personeller<br />
Schwierigkeiten in den Heimen hatte sich das reine Familienprinzip<br />
ad absurdum geführt. Die »Überbeanspruchung der<br />
Kräfte und ihre geringe Freizeit« führten zu häufigem Personalwechsel.<br />
270 Die »Tatsache, daß 33% der Mitarbeiterinnen ihren<br />
Arbeitsplatz wechseln, ist eine Katastrophe«, seufzte die Heimverwaltung.<br />
271 Folgen der Personalnot waren eine als zu gering<br />
erachtete Kapazitätsnutzung der Heime – sie lag 1953 bei 80<br />
Prozent – und die damit verbundenen Kostensteigerungen.<br />
Diese wogen auch deshalb schwer, weil diverse Heime außerhalb<br />
Bremens sehr viel billiger waren, was dazu führte, dass<br />
manche selbst- oder zuzahlende Eltern ihr Kind lieber in einem<br />
solchen als in einem städtischen KWH untergebracht haben<br />
wollten. 272 Abzuwägen waren die Heimkosten außerdem mit<br />
den viel niedrigeren Kosten in Pflegefamilien. Hinzu kam, dass<br />
die Bremer Heime nur unzureichend für eine längerfristige<br />
Unterbringung ausgestattet waren, weil es – vom Fichtenhof<br />
und dem KWH Schönebeck abgesehen – keine eigenen Heimschulen<br />
gab, die andererseits aber als wesentliches Element einer<br />
›guten‹ Betreuung angesehen wurden:<br />
»Bevorzugt werden Heime mit einer Heimschule, einmal für<br />
die schulschwierigen Kinder, aber vor allem, um sicher zu<br />
stellen, daß der schulische Unterricht im Rahmen der<br />
pädagogischen Behandlung der schwererziehbaren Kinder<br />
eine einheitliche und aufeinander abgestimmte Maßnahme<br />
darstellt«. 273<br />
Pädagogisch zog man eher klägliche Konsequenzen aus dem<br />
neuen Konzept. Zur Förderung der Elternarbeit, eigentliche ein<br />
Kernstück zur Restabilisierung der Herkunftsfamilien, wurde<br />
lediglich eine – im KWH Marcusallee angesiedelte – Heimfürsorgestelle<br />
eingerichtet. 274 Auch das eigentliche Heimpersonal<br />
profitierte nicht von dem anspruchsvolleren Konzept. Der Personalschlüssel<br />
blieb noch bis 1959 konstant und über eine<br />
unzureichende formale Qualifikation wurde noch bis in die<br />
1960er Jahre hinein geklagt.<br />
Das Bremerhavener Kinderheim Hohewurth, schon Anfang<br />
1950 vom Bremer Landesjugendamt einer Generalkritik unterzogen,<br />
blieb in den 1950er Jahren in der Schusslinie der Behörden<br />
und mit ihm das Bremerhavener Jugendamt, weil es keine<br />
Abhilfe schuf. 275 Eine 1953 veranlasste Begutachtung durch das<br />
städtische Gesundheitsamt brachte Vernichtendes zutage. Die<br />
Behauptung des Jugendamtes, dass »schwererziehbare Kinder<br />
und Kinder mit krankhaften Anlagen nicht aufgenommen würden«,<br />
sei aus eigener Kenntnis einiger Kinder falsch. Zudem<br />
erhielt die Heimschule das Etikett, »eine als Heimschule deklarierte<br />
Veranda« zu sein. Außerdem bemängelt die Kritik das<br />
unzureichende und unausgebildete Personal. Mehr als drastische<br />
Worte nutzte das Gesundheitsamt für die Beschreibung<br />
der hygienischen Verhältnisse im Heim und auf dem Heimgelände.<br />
Dazu zählten ein »mit Kothaufen verunziert bezw. verstopft<br />
hölzerner Sitzabort im Freigelände des Heims«, gefährliche<br />
Jauchelachen auf den Nachbargrundstücken sowie ein zum<br />
Baden genutzter, aber verseuchter See auf dem Heimgelände.<br />
276<br />
Tatsächlich schreckte das Jugendamt auf. Nach diversen Renovierungen<br />
und einer Teil-Neumöblierung der Kinderzimmer<br />
berichtet das sechs Monate später erneut eingeschaltete<br />
Gesundheitsamt immerhin von einem jetzt »recht günstigen«<br />
Gesamteindruck. 277 Es blieben aber Mängel sowohl hygienischer,<br />
räumlicher und personeller Art, die nicht ohne Weiteres<br />
behoben werden konnten. Dabei handelte es sich um den verdreckten<br />
See und die Unterbringung der Kinder in viel zu kleinen<br />
Schlafräumen. 278 Auch das Personal lebte in Ein- bis- Dreibettzimmern<br />
nicht komfortabel. 279 Die Berichte zum Heim<br />
wurden bis zum Ende des Jahrzehnts freundlicher. Gelobt wurden<br />
die nach 1957 eingerichteten orthopädische Turnstunden<br />
für die Kleinen, der Besuch des Hallenbads für die Älteren, die<br />
von der Jugendleiterin überwachten Turn- und Sportspiele im<br />
Parkgelände, sowie ein in der Zusammensetzung abwechslungsreicher<br />
Speisezettel. Unerfreulich, aber nicht zu verhindern,<br />
blieb die auffallende Blässe vieler Kinder. 280<br />
92