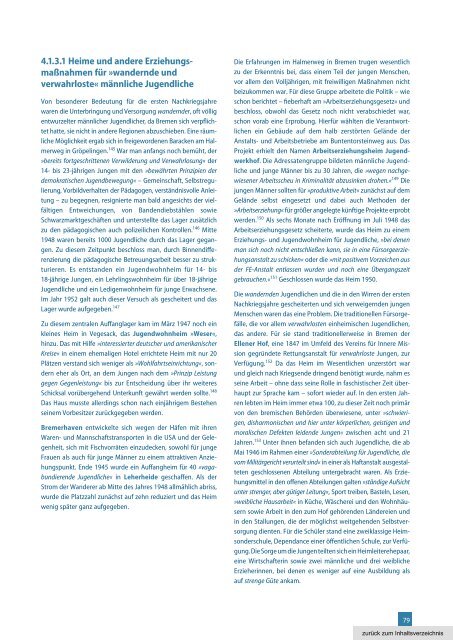1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.1.3.1 Heime und andere Erziehungsmaßnahmen<br />
für »wandernde und<br />
verwahrloste« männliche Jugendliche<br />
Von besonderer Bedeutung für die ersten Nachkriegsjahre<br />
waren die Unterbringung und Versorgung wandernder, oft völlig<br />
entwurzelter männlicher Jugendlicher, da Bremen sich verpflichtet<br />
hatte, sie nicht in andere Regionen abzuschieben. Eine räumliche<br />
Möglichkeit ergab sich in freigewordenen Baracken am Halmerweg<br />
in Gröpelingen. 145 War man anfangs noch bemüht, der<br />
»bereits fortgeschrittenen Verwilderung und Verwahrlosung« der<br />
14- bis 23-jährigen Jungen mit den »bewährten Prinzipien der<br />
demokratischen Jugendbewegung« – Gemeinschaft, Selbstregulierung,<br />
Vorbildverhalten der Pädagogen, verständnisvolle Anleitung<br />
– zu begegnen, resignierte man bald angesichts der vielfältigen<br />
Entweichungen, von Bandendiebstählen sowie<br />
Schwarzmarktgeschäften und unterstellte das Lager zusätzlich<br />
zu den pädagogischen auch polizeilichen Kontrollen. 146 Mitte<br />
1948 waren bereits 1000 Jugendliche durch das Lager gegangen.<br />
Zu diesem Zeitpunkt beschloss man, durch Binnendifferenzierung<br />
die pädagogische Betreuungsarbeit besser zu strukturieren.<br />
Es entstanden ein Jugendwohnheim für 14- bis<br />
18-jährige Jungen, ein Lehrlingswohnheim für über 18-jährige<br />
Jugendliche und ein Ledigenwohnheim für junge Erwachsene.<br />
Im Jahr 1952 galt auch dieser Versuch als gescheitert und das<br />
Lager wurde aufgegeben. 147<br />
Zu diesem zentralen Auffanglager kam im März 1947 noch ein<br />
kleines Heim in Vegesack, das Jugendwohnheim »Weser«,<br />
hinzu. Das mit Hilfe »interessierter deutscher und amerikanischer<br />
Kreise« in einem ehemaligen Hotel errichtete Heim mit nur 20<br />
Plätzen verstand sich weniger als »Wohlfahrtseinrichtung«, sondern<br />
eher als Ort, an dem Jungen nach dem »Prinzip Leistung<br />
gegen Gegenleistung« bis zur Entscheidung über ihr weiteres<br />
Schicksal vorübergehend Unterkunft gewährt werden sollte. 148<br />
Das Haus musste allerdings schon nach einjährigem Bestehen<br />
seinem Vorbesitzer zurückgegeben werden.<br />
Bremerhaven entwickelte sich wegen der Häfen mit ihren<br />
Waren- und Mannschaftstransporten in die USA und der Gelegenheit,<br />
sich mit Fischvorräten einzudecken, sowohl für junge<br />
Frauen als auch für junge Männer zu einem attraktiven Anziehungspunkt.<br />
Ende 1945 wurde ein Auffangheim für 40 »vagabundierende<br />
Jugendliche« in Leherheide geschaffen. Als der<br />
Strom der Wanderer ab Mitte des Jahres 1948 allmählich abriss,<br />
wurde die Platzzahl zunächst auf zehn reduziert und das Heim<br />
wenig später ganz aufgegeben.<br />
Die Erfahrungen im Halmerweg in Bremen trugen wesentlich<br />
zu der Erkenntnis bei, dass einem Teil der jungen Menschen,<br />
vor allem den Volljährigen, mit freiwilligen Maßnahmen nicht<br />
beizukommen war. Für diese Gruppe arbeitete die Politik – wie<br />
schon berichtet – fieberhaft am »Arbeitserziehungsgesetz« und<br />
beschloss, obwohl das Gesetz noch nicht verabschiedet war,<br />
schon vorab eine Erprobung. Hierfür wählten die Verantwortlichen<br />
ein Gebäude auf dem halb zerstörten Gelände der<br />
Anstalts- und Arbeitsbetriebe am Buntentorsteinweg aus. Das<br />
Projekt erhielt den Namen Arbeitserziehungsheim Jugendwerkhof.<br />
Die Adressatengruppe bildeten männliche Jugendliche<br />
und junge Männer bis zu 30 Jahren, die »wegen nachgewiesener<br />
Arbeitsscheu in Kriminalität abzusinken drohen.« 149 Die<br />
jungen Männer sollten für »produktive Arbeit« zunächst auf dem<br />
Gelände selbst eingesetzt und dabei auch Methoden der<br />
»Arbeitserziehung« für größer angelegte künftige Projekte erprobt<br />
werden. 150 Als sechs Monate nach Eröffnung im Juli 1948 das<br />
Arbeitserziehungsgesetz scheiterte, wurde das Heim zu einem<br />
Erziehungs- und Jugendwohnheim für Jugendliche, »bei denen<br />
man sich noch nicht entschließen kann, sie in eine Fürsorgeerziehungsanstalt<br />
zu schicken« oder die »mit positivem Vorzeichen aus<br />
der FE-Anstalt entlassen wurden und noch eine Übergangszeit<br />
gebrauchen.« 151 Geschlossen wurde das Heim 1950.<br />
Die wandernden Jugendlichen und die in den Wirren der ersten<br />
Nachkriegsjahre gescheiterten und sich verweigernden jungen<br />
Menschen waren das eine Problem. Die traditionellen Fürsorgefälle,<br />
die vor allem verwahrlosten einheimischen Jugendlichen,<br />
das andere. Für sie stand traditionellerweise in Bremen der<br />
Ellener Hof, eine 1847 im Umfeld des Vereins für Innere Mission<br />
gegründete Rettungsanstalt für verwahrloste Jungen, zur<br />
Verfügung. 152 Da das Heim im Wesentlichen unzerstört war<br />
und gleich nach Kriegsende dringend benötigt wurde, nahm es<br />
seine Arbeit – ohne dass seine Rolle in faschistischer Zeit überhaupt<br />
zur Sprache kam – sofort wieder auf. In den ersten Jahren<br />
lebten im Heim immer etwa 100, zu dieser Zeit noch primär<br />
von den bremischen Behörden überwiesene, unter »schwierigen,<br />
disharmonischen und hier unter körperlichen, geistigen und<br />
moralischen Defekten leidende Jungen« zwischen acht und 21<br />
Jahren. 153 Unter ihnen befanden sich auch Jugendliche, die ab<br />
Mai 1946 im Rahmen einer »Sonderabteilung für Jugendliche, die<br />
vom Militärgericht verurteilt sind« in einer als Haftanstalt ausgestalteten<br />
geschlossenen Abteilung untergebracht waren. Als Erziehungsmittel<br />
in den offenen Abteilungen galten »ständige Aufsicht<br />
unter strenger, aber gütiger Leitung«, Sport treiben, Basteln, Lesen,<br />
»weibliche Hausarbeit« in Küche, Wäscherei und den Wohnhäusern<br />
sowie Arbeit in den zum Hof gehörenden Ländereien und<br />
in den Stallungen, die der möglichst weitgehenden Selbstversorgung<br />
dienten. Für die Schüler stand eine zweiklassige Heimsonderschule,<br />
Dependance einer öffentlichen Schule, zur Verfügung.<br />
Die Sorge um die Jungen teilten sich ein Heimleiterehepaar,<br />
eine Wirtschafterin sowie zwei männliche und drei weibliche<br />
Erzieherinnen, bei denen es weniger auf eine Ausbildung als<br />
auf strenge Güte ankam.<br />
79