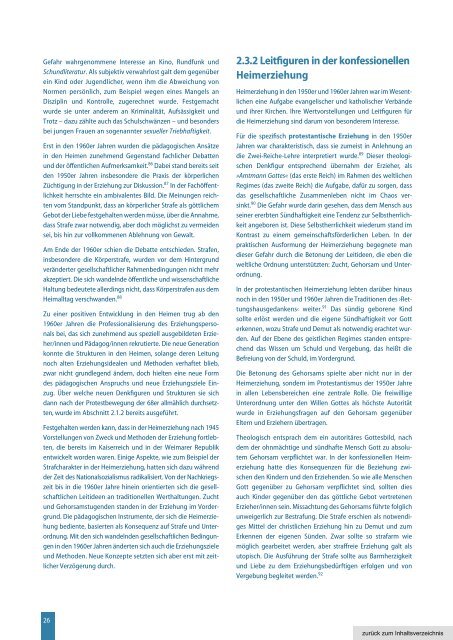1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gefahr wahrgenommene Interesse an Kino, Rundfunk und<br />
Schundliteratur. Als subjektiv verwahrlost galt dem gegenüber<br />
ein Kind oder Jugendlicher, wenn ihm die Abweichung von<br />
Normen persönlich, zum Beispiel wegen eines Mangels an<br />
Disziplin und Kontrolle, zugerechnet wurde. Festgemacht<br />
wurde sie unter anderem an Kriminalität, Aufsässigkeit und<br />
Trotz – dazu zählte auch das Schulschwänzen – und besonders<br />
bei jungen Frauen an sogenannter sexueller Triebhaftigkeit.<br />
Erst in den 1960er Jahren wurden die pädagogischen Ansätze<br />
in den Heimen zunehmend Gegenstand fachlicher Debatten<br />
und der öffentlichen Aufmerksamkeit. 86 Dabei stand bereits seit<br />
den 1950er Jahren insbesondere die Praxis der körperlichen<br />
Züchtigung in der Erziehung zur Diskussion. 87 In der Fachöffentlichkeit<br />
herrschte ein ambivalentes Bild. Die Meinungen reichten<br />
vom Standpunkt, dass an körperlicher Strafe als göttlichem<br />
Gebot der Liebe festgehalten werden müsse, über die Annahme,<br />
dass Strafe zwar notwendig, aber doch möglichst zu vermeiden<br />
sei, bis hin zur vollkommenen Ablehnung von Gewalt.<br />
Am Ende der 1960er schien die Debatte entschieden. Strafen,<br />
insbesondere die Körperstrafe, wurden vor dem Hintergrund<br />
veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen nicht mehr<br />
akzeptiert. Die sich wandelnde öffentliche und wissenschaftliche<br />
Haltung bedeutete allerdings nicht, dass Körperstrafen aus dem<br />
Heimalltag verschwanden. 88<br />
Zu einer positiven Entwicklung in den Heimen trug ab den<br />
1960er Jahren die Professionalisierung des Erziehungspersonals<br />
bei, das sich zunehmend aus speziell ausgebildeten Erzieher/innen<br />
und Pädagog/innen rekrutierte. Die neue Generation<br />
konnte die Strukturen in den Heimen, solange deren Leitung<br />
noch alten Erziehungsidealen und Methoden verhaftet blieb,<br />
zwar nicht grundlegend ändern, doch hielten eine neue Form<br />
des päda gogischen Anspruchs und neue Erziehungsziele Einzug.<br />
Über welche neuen Denkfiguren und Strukturen sie sich<br />
dann nach der Protestbewegung der 68er allmählich durchsetzten,<br />
wurde im Abschnitt 2.1.2 bereits ausgeführt.<br />
Festgehalten werden kann, dass in der Heimerziehung nach 1945<br />
Vorstellungen von Zweck und Methoden der Erziehung fortlebten,<br />
die bereits im Kaiserreich und in der Weimarer Republik<br />
entwickelt worden waren. Einige Aspekte, wie zum Beispiel der<br />
Strafcharakter in der Heimerziehung, hatten sich dazu während<br />
der Zeit des Nationalsozialismus radikalisiert. Von der Nachkriegszeit<br />
bis in die 1960er Jahre hinein orientierten sich die gesellschaftlichen<br />
Leitideen an traditionellen Werthaltungen. Zucht<br />
und Gehorsamstugenden standen in der Erziehung im Vordergrund.<br />
Die pädagogischen Instrumente, der sich die Heimerziehung<br />
bediente, basierten als Konsequenz auf Strafe und Unterordnung.<br />
Mit den sich wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen<br />
in den 1960er Jahren änderten sich auch die Erziehungsziele<br />
und Methoden. Neue Konzepte setzten sich aber erst mit zeitlicher<br />
Verzögerung durch.<br />
2.3.2 Leitfiguren in der konfessionellen<br />
Heimerziehung<br />
Heimerziehung in den 1950er und 1960er Jahren war im Wesentlichen<br />
eine Aufgabe evangelischer und katholischer Verbände<br />
und ihrer Kirchen. Ihre Wertvorstellungen und Leitfiguren für<br />
die Heimerziehung sind darum von besonderem Interesse.<br />
Für die spezifisch protestantische Erziehung in den 1950er<br />
Jahren war charakteristisch, dass sie zumeist in Anlehnung an<br />
die Zwei-Reiche-Lehre interpretiert wurde. 89 Dieser theologischen<br />
Denkfigur entsprechend übernahm der Erzieher, als<br />
»Amtmann Gottes« (das erste Reich) im Rahmen des weltlichen<br />
Regimes (das zweite Reich) die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass<br />
das gesellschaftliche Zusammenleben nicht im Chaos versinkt.<br />
90 Die Gefahr wurde darin gesehen, dass dem Mensch aus<br />
seiner ererbten Sündhaftigkeit eine Tendenz zur Selbstherrlichkeit<br />
angeboren ist. Diese Selbstherrlichkeit wiederum stand im<br />
Kontrast zu einem gemeinschaftsförderlichen Leben. In der<br />
praktischen Ausformung der Heimerziehung begegnete man<br />
dieser Gefahr durch die Betonung der Leitideen, die eben die<br />
weltliche Ordnung unterstützten: Zucht, Gehorsam und Unterordnung.<br />
In der protestantischen Heimerziehung lebten darüber hinaus<br />
noch in den 1950er und 1960er Jahren die Traditionen des ›Rettungshausgedankens‹<br />
weiter. 91 Das sündig geborene Kind<br />
sollte erlöst werden und die eigene Sündhaftigkeit vor Gott<br />
erkennen, wozu Strafe und Demut als notwendig erachtet wurden.<br />
Auf der Ebene des geistlichen Regimes standen entsprechend<br />
das Wissen um Schuld und Vergebung, das heißt die<br />
Befreiung von der Schuld, im Vordergrund.<br />
Die Betonung des Gehorsams spielte aber nicht nur in der<br />
Heimerziehung, sondern im Protestantismus der 1950er Jahre<br />
in allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle. Die freiwillige<br />
Unterordnung unter den Willen Gottes als höchste Autorität<br />
wurde in Erziehungsfragen auf den Gehorsam gegenüber<br />
Eltern und Erziehern übertragen.<br />
Theologisch entsprach dem ein autoritäres Gottesbild, nach<br />
dem der ohnmächtige und sündhafte Mensch Gott zu absolutem<br />
Gehorsam verpflichtet war. In der konfessionellen Heimerziehung<br />
hatte dies Konsequenzen für die Beziehung zwischen<br />
den Kindern und den Erziehenden. So wie alle Menschen<br />
Gott gegenüber zu Gehorsam verpflichtet sind, sollten dies<br />
auch Kinder gegenüber den das göttliche Gebot vertretenen<br />
Erzieher/innen sein. Missachtung des Gehorsams führte folglich<br />
unweigerlich zur Bestrafung. Die Strafe erschien als notwendiges<br />
Mittel der christlichen Erziehung hin zu Demut und zum<br />
Erkennen der eigenen Sünden. Zwar sollte so strafarm wie<br />
möglich gearbeitet werden, aber straffreie Erziehung galt als<br />
utopisch. Die Ausführung der Strafe sollte aus Barmherzigkeit<br />
und Liebe zu dem Erziehungsbedürftigen erfolgen und von<br />
Vergebung begleitet werden. 92<br />
26