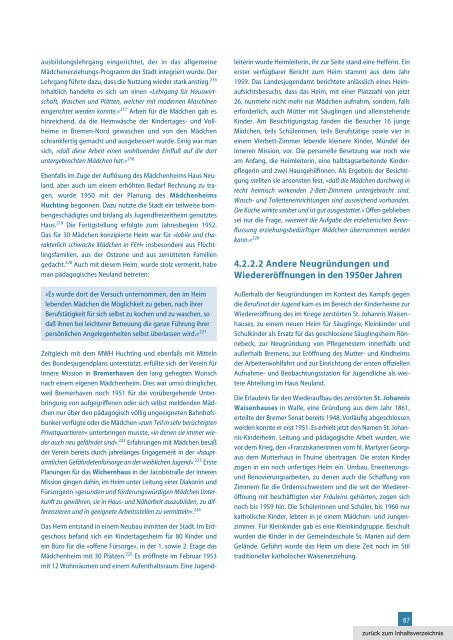1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ausbildungslehrgang eingerichtet, der in das allgemeine<br />
Mädchenerziehungs-Programm der Stadt integriert wurde. Der<br />
Lehrgang führte dazu, dass die Nutzung wieder stark anstieg. 216<br />
Inhaltlich handelte es sich um einen »Lehrgang für Hauswirtschaft,<br />
Waschen und Plätten, welcher mit modernen Maschinen<br />
eingerichtet werden konnte.« 217 Arbeit für die Mädchen gab es<br />
hinreichend, da die Heimwäsche der Kindertages- und Vollheime<br />
in Bremen-Nord gewaschen und von den Mädchen<br />
schrankfertig gemacht und ausgebessert wurde. Einig war man<br />
sich, »daß diese Arbeit einen wohltuenden Einfluß auf die dort<br />
untergebrachten Mädchen hat.« 218<br />
Ebenfalls im Zuge der Auflösung des Mädchenheims Haus Neuland,<br />
aber auch um einem erhöhten Bedarf Rechnung zu tragen,<br />
wurde 1950 mit der Planung des Mädchenheims<br />
Huchting begonnen. Dazu nutzte die Stadt ein teilweise bombengeschädigtes<br />
und bislang als Jugendfreizeitheim genutztes<br />
Haus. 219 Die Fertigstellung erfolgte zum Jahresbeginn 1952.<br />
Das für 30 Mädchen konzipierte Heim war für »labile und charakterlich<br />
schwache Mädchen in FEH« insbesondere aus Flüchtlingsfamilien,<br />
aus der Ostzone und aus zerrütteten Familien<br />
gedacht. 220 Auch mit diesem Heim, wurde stolz vermerkt, habe<br />
man pädagogisches Neuland betreten:<br />
»Es wurde dort der Versuch unternommen, den im Heim<br />
lebenden Mädchen die Möglichkeit zu geben, nach ihrer<br />
Berufstätigkeit für sich selbst zu kochen und zu waschen, so<br />
daß ihnen bei leichterer Betreuung die ganze Führung ihrer<br />
persönlichen Angelegenheiten selbst überlassen wird.« 221<br />
Zeitgleich mit dem MWH Huchting und ebenfalls mit Mitteln<br />
des Bundesjugendplans unterstützt, erfüllte sich der Verein für<br />
Innere Mission in Bremerhaven den lang gehegten Wunsch<br />
nach einem eigenen Mädchenheim. Dies war umso dringlicher,<br />
weil Bremerhaven noch 1951 für die vorübergehende Unterbringung<br />
von aufgegriffenen oder sich selbst meldenden Mädchen<br />
nur über den pädagogisch völlig ungeeigneten Bahnhofsbunker<br />
verfügte oder die Mädchen »zum Teil in sehr berüchtigten<br />
Privatquartieren« unterbringen musste, »in denen sie immer wieder<br />
auch neu gefährdet sind«. 222 Erfahrungen mit Mädchen besaß<br />
der Verein bereits durch jahrelanges Engagement in der »hauptamtlichen<br />
Gefährdetenfürsorge an der weiblichen Jugend«. 223 Erste<br />
Planungen für das Wichernhaus in der Jacobistraße der Inneren<br />
Mission gingen dahin, im Heim unter Leitung einer Diakonin und<br />
Fürsorgerin »gesunden und förderungswürdigen Mädchen Unterkunft<br />
zu gewähren, sie in Haus- und Näharbeit auszu bilden, zu differenzieren<br />
und in geeignete Arbeitsstellen zu ver mitteln«. 224<br />
Das Heim entstand in einem Neubau inmitten der Stadt. Im Erdgeschoss<br />
befand sich ein Kindertagesheim für 80 Kinder und<br />
ein Büro für die »offene Fürsorge«, in der 1. sowie 2. Etage das<br />
Mädchenheim mit 30 Plätzen. 225 Es eröffnete im Februar 1953<br />
mit 12 Wohnräumen und einem Aufenthaltsraum. Eine Jugendleiterin<br />
wurde Heimleiterin, ihr zur Seite stand eine Helferin. Ein<br />
erster verfügbarer Bericht zum Heim stammt aus dem Jahr<br />
1959. Das Landesjugendamt berichtete anlässlich eines Heimaufsichtsbesuchs,<br />
dass das Heim, mit einer Platzzahl von jetzt<br />
26, nunmehr nicht mehr nur Mädchen aufnahm, sondern, falls<br />
erforderlich, auch Mütter mit Säuglingen und alleinstehende<br />
Kinder. Am Besichtigungstag fanden die Besucher 16 junge<br />
Mädchen, teils Schülerinnen, teils Berufstätige sowie vier in<br />
einem Vierbett-Zimmer lebende kleinere Kinder, Mündel der<br />
Inneren Mission, vor. Die personelle Besetzung war noch wie<br />
am Anfang, die Heimleiterin, eine halbtagsarbeitende Kinderpflegerin<br />
und zwei Hausgehilfinnen. Als Ergebnis der Besichtigung<br />
stellten sie ansonsten fest, »daß die Mädchen durchweg in<br />
recht heimisch wirkenden 2-Bett-Zimmern untergebracht sind.<br />
Wasch- und Toiletteneinrichtungen sind ausreichend vorhanden.<br />
Die Küche wirkte sauber und ist gut ausgestattet.« Offen geblieben<br />
sei nur die Frage, »wieweit die Aufgabe der erzieherischen Beeinflussung<br />
erziehungsbedürftiger Mädchen übernommen werden<br />
kann.« 226<br />
4.2.2.2 Andere Neugründungen und<br />
Wiedereröffnungen in den 1950er Jahren<br />
Außerhalb der Neugründungen im Kontext des Kampfs gegen<br />
die Berufsnot der Jugend kam es im Bereich der Kinderheime zur<br />
Wiedereröffnung des im Kriege zerstörten St. Johannis Waisenhauses,<br />
zu einem neuen Heim für Säuglinge, Kleinkinder und<br />
Schulkinder als Ersatz für das geschlossene Säuglingsheim Rönnebeck,<br />
zur Neugründung von Pflegenestern innerhalb und<br />
außerhalb Bremens, zur Eröffnung des Mutter- und Kindheims<br />
der Arbeiterwohlfahrt und zur Einrichtung der ersten offiziellen<br />
Aufnahme- und Beobachtungsstation für Jugendliche als weitere<br />
Abteilung im Haus Neuland.<br />
Die Erlaubnis für den Wiederaufbau des zerstörten St. Johannis<br />
Waisenhauses in Walle, eine Gründung aus dem Jahr 1861,<br />
erteilte der Bremer Senat bereits 1948. Vorläufig abgeschlossen<br />
werden konnte er erst 1951. Es erhielt jetzt den Namen St. Johannis-Kinderheim.<br />
Leitung und pädagogische Arbeit wurden, wie<br />
vor dem Krieg, den »Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg«<br />
aus dem Mutterhaus in Thuine übertragen. Die ersten Kinder<br />
zogen in ein noch unfertiges Heim ein. Umbau, Erweiterungsund<br />
Renovierungsarbeiten, zu denen auch die Schaffung von<br />
Zimmern für die Ordensschwestern und die seit der Wiedereröffnung<br />
mit beschäftigten vier Fräuleins gehörten, zogen sich<br />
noch bis 1959 hin. Die Schülerinnen und Schüler, bis 1960 nur<br />
katholische Kinder, lebten in je einem Mädchen- und Jungenzimmer.<br />
Für Kleinkinder gab es eine Kleinkindgruppe. Beschult<br />
wurden die Kinder in der Gemeindeschule St. Marien auf dem<br />
Gelände. Geführt wurde das Heim um diese Zeit noch im Stil<br />
traditioneller katholischer Waisenerziehung.<br />
87