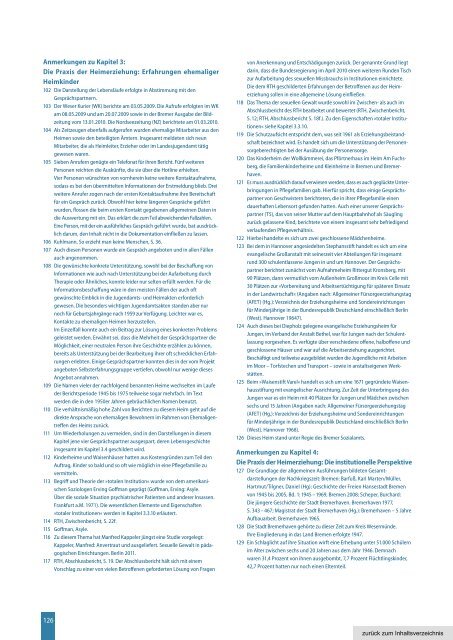1qDBULH
1qDBULH
1qDBULH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anmerkungen zu Kapitel 3:<br />
Die Praxis der Heimerziehung: Erfahrungen ehemaliger<br />
Heimkinder<br />
102 Die Darstellung der Lebensläufe erfolgte in Abstimmung mit den<br />
Gesprächspartnern.<br />
103 Der Weser Kurier (WK) berichte am 03.05.2009. Die Aufrufe erfolgten im WK<br />
am 08.05.2009 und am 20.07.2009 sowie in der Bremer Ausgabe der Bildzeitung<br />
vom 13.01.2010. Die Nordseezeitung (NZ) berichtete am 01.03.2010.<br />
104 Als Zeitzeugen ebenfalls aufgerufen wurden ehemalige Mitarbeiter aus den<br />
Heimen sowie den beteiligten Ämtern. Insgesamt meldeten sich neun<br />
Mitarbeiter, die als Heimleiter, Erzieher oder im Landes jugendamt tätig<br />
gewesen waren.<br />
105 Sieben Anrufern genügte ein Telefonat für ihren Bericht. Fünf weiteren<br />
Personen reichten die Auskünfte, die sie über die Hotline erhielten.<br />
Vier Personen wünschten von vornherein keine weitere Kontaktaufnahme,<br />
sodass es bei den übermittelten Informationen der Erstmeldung blieb. Drei<br />
weitere Anrufer zogen nach der ersten Kontaktaufnahme ihre Bereitschaft<br />
für ein Gespräch zurück. Obwohl hier keine längeren Gespräche geführt<br />
wurden, flossen die beim ersten Kontakt gegebenen allgemeinen Daten in<br />
die Auswertung mit ein. Das erklärt die zum Teil abweichenden Fallzahlen.<br />
Eine Person, mit der ein ausführliches Gespräch geführt wurde, bat ausdrücklich<br />
darum, den Inhalt nicht in die Dokumentation einfließen zu lassen.<br />
106 Kuhlmann, So erzieht man keine Menschen, S. 36.<br />
107 Auch diesen Personen wurde ein Gespräch angeboten und in allen Fällen<br />
auch angenommen.<br />
108 Die gewünschte konkrete Unterstützung, sowohl bei der Beschaffung von<br />
Informationen wie auch nach Unterstützung bei der Aufarbeitung durch<br />
Therapie oder Ähnliches, konnte leider nur selten erfüllt werden. Für die<br />
Informationsbeschaffung wäre in den meisten Fällen der auch oft<br />
gewünschte Einblick in die Jugendamts- und Heimakten erforderlich<br />
gewesen. Die besonders wichtigen Jugendamtsakten standen aber nur<br />
noch für Geburtsjahrgänge nach 1959 zur Verfügung. Leichter war es,<br />
Kontakte zu ehemaligen Heimen herzustellen.<br />
Im Einzelfall konnte auch ein Beitrag zur Lösung eines konkreten Problems<br />
geleistet werden. Erwähnt sei, dass die Mehrheit der Gesprächspartner die<br />
Möglichkeit, einer neutralen Person ihre Geschichte erzählen zu können,<br />
bereits als Unterstützung bei der Bearbeitung ihrer oft schrecklichen Erfahrungen<br />
erlebten. Einige Gesprächspartner konnten dies in der vom Projekt<br />
angeboten Selbsterfahrungsgruppe vertiefen, obwohl nur wenige dieses<br />
Angebot annahmen.<br />
109 Die Namen vieler der nachfolgend benannten Heime wechselten im Laufe<br />
der Berichtsperiode 1945 bis 1975 teilweise sogar mehrfach. Im Text<br />
werden die in den 1950er Jahren gebräuchlichen Namen benutzt.<br />
110 Die verhältnismäßig hohe Zahl von Berichten zu diesem Heim geht auf die<br />
direkte Ansprache von ehemaligen Bewohnern im Rahmen von Ehemaligentreffen<br />
des Heims zurück.<br />
111 Um Wiederholungen zu vermeiden, sind in den Darstellungen in diesem<br />
Kapitel jene vier Gesprächspartner ausgespart, deren Lebensgeschichte<br />
insgesamt im Kapitel 3.4 geschildert wird.<br />
112 Kinderheime und Waisenhäuser hatten aus Kostengründen zum Teil den<br />
Auftrag, Kinder so bald und so oft wie möglich in eine Pflege familie zu<br />
vermitteln.<br />
113 Begriff und Theorie der »totalen Institution« wurde von dem amerikanischen<br />
Soziologen Erving Goffman geprägt (Goffman, Erving: Asyle.<br />
Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen.<br />
Frankfurt a.M. 1971). Die wesentlichen Elemente und Eigenschaften<br />
»totaler Institutionen« werden in Kapitel 3.3.10 erläutert.<br />
114 RTH, Zwischenbericht, S. 22f.<br />
115 Goffman, Asyle.<br />
116 Zu diesem Thema hat Manfred Kappeler jüngst eine Studie vorgelegt:<br />
Kappeler, Manfred: Anvertraut und ausgeliefert. Sexuelle Gewalt in pädagogischen<br />
Einrichtungen. Berlin 2011.<br />
117 RTH, Abschlussbericht, S. 19. Der Abschlussbericht hält sich mit einem<br />
Vorschlag zu einer von vielen Betroffenen geforderten Lösung von Fragen<br />
von Anerkennung und Entschädigungen zurück. Der genannte Grund liegt<br />
darin, dass die Bundesregierung im April 2010 einen weiteren Runden Tisch<br />
zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in Institutionen einrichtete.<br />
Die dem RTH geschilderten Erfahrungen der Betroffenen aus der Heimerziehung<br />
sollen in eine allgemeine Lösung einfließen.<br />
118 Das Thema der sexuellen Gewalt wurde sowohl im Zwischen- als auch im<br />
Abschlussbericht des RTH bearbeitet und bewertet (RTH, Zwischenbericht,<br />
S. 12; RTH, Abschlussbericht S. 18f.). Zu den Eigenschaften »totaler Institutionen«<br />
siehe Kapitel 3.3.10.<br />
119 Die Schutzaufsicht entspricht dem, was seit 1961 als Erziehungsbeistandschaft<br />
bezeichnet wird. Es handelt sich um die Unterstützung der Personensorgeberechtigten<br />
bei der Ausübung der Personensorge.<br />
120 Das Kinderheim der Wollkämmerei, das Pförtnerhaus im Heim Am Fuchsberg,<br />
die Familienkinderheime und Kleinheime in Bremen und Bremerhaven.<br />
121 Es muss ausdrücklich darauf verwiesen werden, dass es auch geglückte Unterbringungen<br />
in Pflegefamilien gab. Hierfür spricht, dass einige Gesprächspartner<br />
von Geschwistern berichteten, die in ihrer Pflegefamilie einen<br />
dauerhaften Lebensort gefunden hatten. Auch einer unserer Gesprächspartner<br />
(T5), das von seiner Mutter auf dem Hauptbahnhof als Säugling<br />
zurück gelassene Kind, berichtete von einem insgesamt sehr befriedigend<br />
verlaufenden Pflegeverhältnis.<br />
122 Hierbei handelte es sich um zwei geschlossene Mädchenheime.<br />
123 Bei dem in Hannover angesiedelten Stephansstift handelt es sich um eine<br />
evangelische Großanstalt mit seinerzeit vier Abteilungen für insgesamt<br />
rund 300 schulentlassene Jungen in und um Hannover. Der Gesprächspartner<br />
berichtet zunächst vom Aufnahmeheim Rittergut Kronsberg, mit<br />
90 Plätzen, dann vermutlich vom Außenheim Großmoor im Kreis Celle mit<br />
30 Plätzen zur »Vorbereitung und Arbeitsertüchtigung für späteren Einsatz<br />
in der Landwirtschaft« (Angaben nach: Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag<br />
(AFET) (Hg.): Verzeichnis der Erziehungsheime und Sondereinrichtungen<br />
für Minderjährige in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin<br />
(West). Hannover 19647).<br />
124 Auch dieses bei Diepholz gelegene evangelische Erziehungsheim für<br />
Jungen, im Verband der Anstalt Bethel, war für Jungen nach der Schulentlassung<br />
vorgesehen. Es verfügte über verschiedene offene, halboffene und<br />
geschlossene Häuser und war auf die Arbeitserziehung ausgerichtet.<br />
Beschäftigt und teilweise ausgebildet wurden die Jugendliche mit Arbeiten<br />
im Moor – Torfstechen und Transport – sowie in anstaltseigenen Werkstätten.<br />
125 Beim »Waisenstift Varel« handelt es sich um eine 1671 gegründete Waisenhausstiftung<br />
mit evangelischer Ausrichtung. Zur Zeit der Unterbringung des<br />
Jungen war es ein Heim mit 40 Plätzen für Jungen und Mädchen zwischen<br />
sechs und 15 Jahren (Angaben nach: Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag<br />
(AFET) (Hg.): Verzeichnis der Erziehungsheime und Sondereinrichtungen<br />
für Minderjährige in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin<br />
(West). Hannover 1968).<br />
126 Dieses Heim stand unter Regie des Bremer Sozialamts.<br />
Anmerkungen zu Kapitel 4:<br />
Die Praxis der Heimerziehung: Die institutionelle Perspektive<br />
127 Die Grundlage der allgemeinen Ausführungen bildeten Gesamtdarstellungen<br />
der Nachkriegszeit: Bremen: Barfuß, Karl Marten/Müller,<br />
Hartmut/Tilgner, Daniel (Hg): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen<br />
von 1945 bis 2005, Bd. 1: 1945 – 1969, Bremen 2008; Scheper, Burchard:<br />
Die jüngere Geschichte der Stadt Bremerhaven. Bremerhaven 1977,<br />
S. 343 – 467; Magistrat der Stadt Bremerhaven (Hg.): Bremerhaven – 5 Jahre<br />
Aufbauarbeit. Bremerhaven 1965.<br />
128 Die Stadt Bremerhaven gehörte zu dieser Zeit zum Kreis Wesermünde.<br />
Ihre Eingliederung in das Land Bremen erfolgte 1947.<br />
129 Ein Schlaglicht auf ihre Situation wirft eine Erhebung unter 51.000 Schülern<br />
im Alter zwischen sechs und 20 Jahren aus dem Jahr 1946. Demnach<br />
waren 31,4 Prozent von ihnen ausgebombt, 7,7 Prozent Flüchtlingskinder,<br />
42,7 Prozent hatten nur noch einen Elternteil.<br />
126