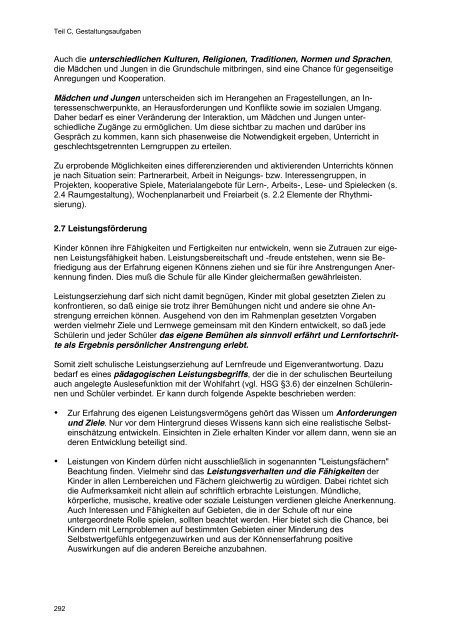Rahmenplan Grundschule Hessen
Rahmenplan Grundschule Hessen
Rahmenplan Grundschule Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Teil C, Gestaltungsaufgaben<br />
Auch die unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Traditionen, Normen und Sprachen,<br />
die Mädchen und Jungen in die <strong>Grundschule</strong> mitbringen, sind eine Chance für gegenseitige<br />
Anregungen und Kooperation.<br />
Mädchen und Jungen unterscheiden sich im Herangehen an Fragestellungen, an Interessenschwerpunkte,<br />
an Herausforderungen und Konflikte sowie im sozialen Umgang.<br />
Daher bedarf es einer Veränderung der Interaktion, um Mädchen und Jungen unterschiedliche<br />
Zugänge zu ermöglichen. Um diese sichtbar zu machen und darüber ins<br />
Gespräch zu kommen, kann sich phasenweise die Notwendigkeit ergeben, Unterricht in<br />
geschlechtsgetrennten Lerngruppen zu erteilen.<br />
Zu erprobende Möglichkeiten eines differenzierenden und aktivierenden Unterrichts können<br />
je nach Situation sein: Partnerarbeit, Arbeit in Neigungs- bzw. Interessengruppen, in<br />
Projekten, kooperative Spiele, Materialangebote für Lern-, Arbeits-, Lese- und Spielecken (s.<br />
2.4 Raumgestaltung), Wochenplanarbeit und Freiarbeit (s. 2.2 Elemente der Rhythmisierung).<br />
2.7 Leistungsförderung<br />
Kinder können ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten nur entwickeln, wenn sie Zutrauen zur eigenen<br />
Leistungsfähigkeit haben. Leistungsbereitschaft und -freude entstehen, wenn sie Befriedigung<br />
aus der Erfahrung eigenen Könnens ziehen und sie für ihre Anstrengungen Anerkennung<br />
finden. Dies muß die Schule für alle Kinder gleichermaßen gewährleisten.<br />
Leistungserziehung darf sich nicht damit begnügen, Kinder mit global gesetzten Zielen zu<br />
konfrontieren, so daß einige sie trotz ihrer Bemühungen nicht und andere sie ohne Anstrengung<br />
erreichen können. Ausgehend von den im <strong>Rahmenplan</strong> gesetzten Vorgaben<br />
werden vielmehr Ziele und Lernwege gemeinsam mit den Kindern entwickelt, so daß jede<br />
Schülerin und jeder Schüler das eigene Bemühen als sinnvoll erfährt und Lernfortschritte<br />
als Ergebnis persönlicher Anstrengung erlebt.<br />
Somit zielt schulische Leistungserziehung auf Lernfreude und Eigenverantwortung. Dazu<br />
bedarf es eines pädagogischen Leistungsbegriffs, der die in der schulischen Beurteilung<br />
auch angelegte Auslesefunktion mit der Wohlfahrt (vgl. HSG §3.6) der einzelnen Schülerinnen<br />
und Schüler verbindet. Er kann durch folgende Aspekte beschrieben werden:<br />
• Zur Erfahrung des eigenen Leistungsvermögens gehört das Wissen um Anforderungen<br />
und Ziele. Nur vor dem Hintergrund dieses Wissens kann sich eine realistische Selbsteinschätzung<br />
entwickeln. Einsichten in Ziele erhalten Kinder vor allem dann, wenn sie an<br />
deren Entwicklung beteiligt sind.<br />
• Leistungen von Kindern dürfen nicht ausschließlich in sogenannten "Leistungsfächern"<br />
Beachtung finden. Vielmehr sind das Leistungsverhalten und die Fähigkeiten der<br />
Kinder in allen Lernbereichen und Fächern gleichwertig zu würdigen. Dabei richtet sich<br />
die Aufmerksamkeit nicht allein auf schriftlich erbrachte Leistungen. Mündliche,<br />
körperliche, musische, kreative oder soziale Leistungen verdienen gleiche Anerkennung.<br />
Auch Interessen und Fähigkeiten auf Gebieten, die in der Schule oft nur eine<br />
untergeordnete Rolle spielen, sollten beachtet werden. Hier bietet sich die Chance, bei<br />
Kindern mit Lernproblemen auf bestimmten Gebieten einer Minderung des<br />
Selbstwertgefühls entgegenzuwirken und aus der Könnenserfahrung positive<br />
Auswirkungen auf die anderen Bereiche anzubahnen.<br />
292