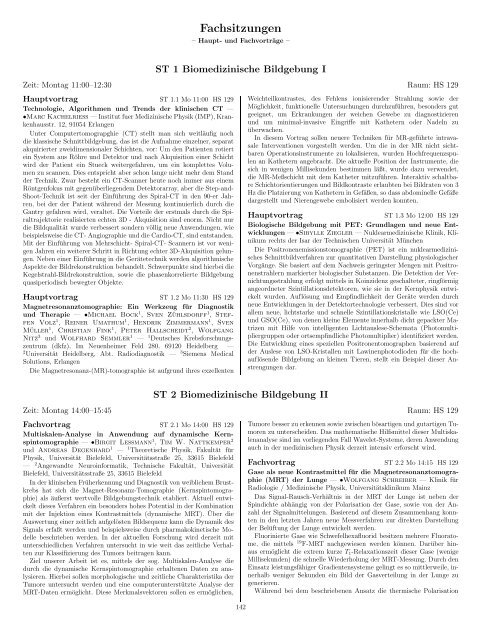aktualisiertes pdf - DPG-Tagungen
aktualisiertes pdf - DPG-Tagungen
aktualisiertes pdf - DPG-Tagungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachsitzungen<br />
– Haupt- und Fachvorträge –<br />
ST 1 Biomedizinische Bildgebung I<br />
Zeit: Montag 11:00–12:30 Raum: HS 129<br />
Hauptvortrag ST 1.1 Mo 11:00 HS 129<br />
Technologie, Algorithmen und Trends der klinischen CT —<br />
•Marc Kachelriess — Institut fuer Medizinische Physik (IMP), Krankenhausstr.<br />
12, 91054 Erlangen<br />
Unter Computertomograpghie (CT) stellt man sich weitläufig noch<br />
die klassische Schnittbildgebung, das ist die Aufnahme einzelner, separat<br />
akquirierter zweidimensionaler Schichten, vor: Um den Patienten rotiert<br />
ein System aus Röhre und Detektor und nach Akquisition einer Schicht<br />
wird der Patient ein Stueck weitergefahren, um ein komplettes Volumen<br />
zu scannen. Dies entspricht aber schon lange nicht mehr dem Stand<br />
der Technik. Zwar besteht ein CT-Scanner heute noch immer aus einem<br />
Röntgenfokus mit gegenüberliegendem Detektorarray, aber die Step-and-<br />
Shoot-Technik ist seit der Einführung des Spiral-CT in den 90-er Jahren,<br />
bei der der Patient während der Messung kontinuierlich durch die<br />
Gantry gefahren wird, veraltet. Die Vorteile der erstmals durch die Spiraltrajektorie<br />
realisierten echten 3D - Akquisition sind enorm. Nicht nur<br />
die Bildqualität wurde verbessert sondern völlig neue Anwendungen, wie<br />
beispielsweise die CT- Angiographie und die Cardio-CT, sind entstanden.<br />
Mit der Einführung von Mehrschicht- Spiral-CT- Scannern ist vor wenigen<br />
Jahren ein weiterer Schritt in Richtung echter 3D-Akquisition gelungen.<br />
Neben einer Einführung in die Gerätetechnik werden algorithmische<br />
Aspekte der Bildrekonstruktion behandelt. Schwerpunkte sind hierbei die<br />
Kegelstrahl-Bildrekonstruktion, sowie die phasenkorrelierte Bildgebung<br />
quasiperiodisch bewegter Objekte.<br />
Hauptvortrag ST 1.2 Mo 11:30 HS 129<br />
Magnetresonanztomographie: Ein Werkzeug für Diagnostik<br />
und Therapie — •Michael Bock 1 , Sven Zühlsdorff 1 , Steffen<br />
Volz 1 , Reiner Umathum 1 , Hendrik Zimmermann 1 , Sven<br />
Müller 1 , Christian Fink 1 , Peter Hallscheidt 2 , Wolfgang<br />
Nitz 3 und Wolfhard Semmler 1 — 1 Deutsches Krebsforschungszentrum<br />
(dkfz), Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg —<br />
2 Universität Heidelberg, Abt. Radiodiagnostik — 3 Siemens Medical<br />
Solutions, Erlangen<br />
Die Magnetresonanz-(MR)-tomographie ist aufgrund ihres exzellenten<br />
ST 2 Biomedizinische Bildgebung II<br />
Weichteilkontrastes, des Fehlens ionisierender Strahlung sowie der<br />
Möglichkeit, funktionelle Untersuchungen durchzuführen, besonders gut<br />
geeignet, um Erkrankungen der weichen Gewebe zu diagnostizieren<br />
und um minimal-invasive Eingriffe mit Kathetern oder Nadeln zu<br />
überwachen.<br />
In diesem Vortrag sollen neuere Techniken für MR-geführte intravasale<br />
Interventionen vorgestellt werden. Um die in der MR nicht sichtbaren<br />
Operationsinstrumente zu lokalisieren, wurden Hochfrequenzspulen<br />
an Kathetern angebracht. Die aktuelle Position der Instrumente, die<br />
sich in wenigen Millisekunden bestimmen läßt, wurde dazu verwendet,<br />
die MR-Meßschicht mit dem Katheter mitzuführen. Interaktiv schaltbare<br />
Schichtorientierungen und Bildkontraste erlaubten bei Bildraten von 3<br />
Hz die Platzierung von Kathetern in Gefäßen, so dass abdominelle Gefäße<br />
dargestellt und Nierengewebe embolisiert werden konnten.<br />
Hauptvortrag ST 1.3 Mo 12:00 HS 129<br />
Biologische Bildgebung mit PET: Grundlagen und neue Entwicklungen<br />
— •Sibylle Ziegler — Nuklearmedizinische Klinik, Klinikum<br />
rechts der Isar der Technischen Universität München<br />
Die Positronenemissionstomographie (PET) ist ein nuklearmedizinisches<br />
Schnittbildverfahren zur quantitativen Darstellung physiologischer<br />
Vorgänge. Sie basiert auf dem Nachweis geringster Mengen mit Positronenstrahlern<br />
markierter biologischer Substanzen. Die Detektion der Vernichtungsstrahlung<br />
erfolgt mittels in Koinzidenz geschalteter, ringförmig<br />
angeordneter Szintillationsdetektoren, wie sie in der Kernphysik entwickelt<br />
wurden. Auflösung und Empfindlichkeit der Geräte werden durch<br />
neue Entwicklungen in der Detektortechnologie verbessert. Dies sind vor<br />
allem neue, lichtstarke und schnelle Szintillationskristalle wie LSO(Ce)<br />
und GSO(Ce), von denen kleine Elemente innerhalb dicht gepackter Matrizen<br />
mit Hilfe von intelligenten Lichtauslese-Schemata (Photomultipliergruppen<br />
oder ortsempfindliche Photomultiplier) identifiziert werden.<br />
Die Entwicklung eines speziellen Positronentomographen basierend auf<br />
der Auslese von LSO-Kristallen mit Lawinenphotodioden für die hochauflösende<br />
Bildgebung an kleinen Tieren, stellt ein Beispiel dieser Anstrengungen<br />
dar.<br />
Zeit: Montag 14:00–15:45 Raum: HS 129<br />
Fachvortrag ST 2.1 Mo 14:00 HS 129<br />
Multiskalen-Analyse in Anwendung auf dynamische Kernspintomographie<br />
— •Birgit Lessmann 1 , Tim W. Nattkemper 2<br />
und Andreas Degenhard 1 — 1 Theoretische Physik, Fakultät für<br />
Physik, Universität Bielefeld, Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld<br />
— 2 Angewandte Neuroinformatik, Technische Fakultät, Universität<br />
Bielefeld, Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld<br />
In der klinischen Früherkennung und Diagnostik von weiblichem Brustkrebs<br />
hat sich die Magnet-Resonanz-Tomographie (Kernspintomographie)<br />
als äußerst wertvolle Bildgebungstechnik etabliert. Aktuell entwickelt<br />
dieses Verfahren ein besonders hohes Potential in der Kombination<br />
mit der Injektion eines Kontrastmittels (dynamische MRT). Über die<br />
Auswertung einer zeitlich aufgelösten Bildsequenz kann die Dynamik des<br />
Signals erfaßt werden und beispielsweise durch pharmakokinetische Modelle<br />
beschrieben werden. In der aktuellen Forschung wird derzeit mit<br />
unterschiedlichen Verfahren untersucht in wie weit das zeitliche Verhalten<br />
zur Klassifizierung des Tumors beitragen kann.<br />
Ziel unserer Arbeit ist es, mittels der sog. Multiskalen-Analyse die<br />
durch die dynamische Kernspintomographie erhaltenen Daten zu analysieren.<br />
Hierbei sollen morphologische und zeitliche Charakteristika der<br />
Tumore untersucht werden und eine computerunterstützte Analyse der<br />
MRT-Daten ermöglicht. Diese Merkmalsvektoren sollen es ermöglichen,<br />
142<br />
Tumore besser zu erkennen sowie zwischen bösartigen und gutartigen Tumoren<br />
zu unterscheiden. Das mathematische Hilfsmittel dieser Multiskalenanalyse<br />
sind im vorliegenden Fall Wavelet-Systeme, deren Anwendung<br />
auch in der medizinischen Physik derzeit intensiv erforscht wird.<br />
Fachvortrag ST 2.2 Mo 14:15 HS 129<br />
Gase als neue Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie<br />
(MRT) der Lunge — •Wolfgang Schreiber — Klinik für<br />
Radiologie / Medizinische Physik, Universitätsklinikum Mainz<br />
Das Signal-Rausch-Verhältnis in der MRT der Lunge ist neben der<br />
Spindichte abhängig von der Polarisation der Gase, sowie von der Anzahl<br />
der Signalmittelungen. Basierend auf diesem Zusammenhang konnten<br />
in den letzten Jahren neue Messverfahren zur direkten Darstellung<br />
der Belüftung der Lunge entwickelt werden.<br />
Fluorinierte Gase wie Schwefelhexafluorid besitzen mehrere Fluoratome,<br />
die mittels 19 F-MRT nachgewiesen werden können. Darüber hinaus<br />
ermöglicht die extrem kurze T1-Relaxationszeit dieser Gase (wenige<br />
Millisekunden) die schnelle Wiederholung der MRT-Messung. Durch den<br />
Einsatz leistungsfähiger Gradientensysteme gelingt es so mittlerweile, innerhalb<br />
weniger Sekunden ein Bild der Gasverteilung in der Lunge zu<br />
generieren.<br />
Während bei dem beschriebenen Ansatz die thermische Polarisation