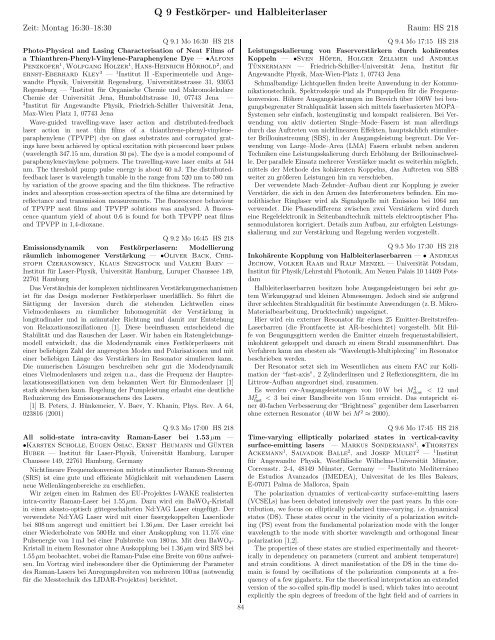aktualisiertes pdf - DPG-Tagungen
aktualisiertes pdf - DPG-Tagungen
aktualisiertes pdf - DPG-Tagungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Q 9 Festkörper- und Halbleiterlaser<br />
Zeit: Montag 16:30–18:30 Raum: HS 218<br />
Q 9.1 Mo 16:30 HS 218<br />
Photo-Physical and Lasing Characterisation of Neat Films of<br />
a Thianthren-Phenyl-Vinylene-Paraphenylene Dye — •Alfons<br />
Penzkofer 1 , Wolfgang Holzer 1 , Hans-Heinrich Hörhold 2 , and<br />
ernst-Eberhard Kley 3 — 1 Institut II -Experimentelle und Angewandte<br />
Physik, Universität Regensburg, Universitätsstrasse 31, 93053<br />
Regensburg — 2 Institut für Organische Chemie und Makromolekulare<br />
Chemie der Universität Jena, Humboldtstrasse 10, 07743 Jena —<br />
3 Institut für Angewandte Physik, Friedrich-Schiller Universität Jena,<br />
Max-Wien Platz 1, 07743 Jena<br />
Wave-guided travelling-wave laser action and distributed-feedback<br />
laser action in neat thin films of a thianthrene-phenyl-vinyleneparaphenylene<br />
(TPVPP) dye on glass substrates and corrugated gratings<br />
have been achieved by optical excitation with picosecond laser pulses<br />
(wavelength 347.15 nm, duration 30 ps). The dye is a model compound of<br />
paraphenylenevinylene polymers. The travelling-wave laser emits at 544<br />
nm. The threshold pump pulse energy is about 60 nJ. The distributedfeedback<br />
laser is wavelength tunable in the range from 520 nm to 580 nm<br />
by variation of the groove spacing and the film thickness. The refractive<br />
index and absorption cross-section spectra of the films are determined by<br />
reflectance and transmission measurements. The fluorescence behaviour<br />
of TPVPP neat films and TPVPP solutions was analysed. A fluorescence<br />
quantum yield of about 0.6 is found for both TPVPP neat films<br />
and TPVPP in 1,4-dioxane.<br />
Q 9.2 Mo 16:45 HS 218<br />
Emissionsdynamik von Festkörperlasern: Modellierung<br />
räumlich inhomogener Verstärkung — •Oliver Back, Christoph<br />
Czeranowsky, Klaus Sengstock und Valeri Baev —<br />
Institut für Laser-Physik, Universität Hamburg, Luruper Chaussee 149,<br />
22761 Hamburg<br />
Das Verständnis der komplexen nichtlinearen Verstärkungsmechanismen<br />
ist für das Design moderner Festkörperlaser unerläßlich. So führt die<br />
Sättigung der Inversion durch die stehenden Lichtwellen eines<br />
Vielmodenlasers zu räumlicher Inhomogenität der Verstärkung in<br />
longitudinaler und in azimutaler Richtung und damit zur Entstehung<br />
von Relaxationsoszillationen [1]. Diese beeinflussen entscheidend die<br />
Stabilität und das Rauschen der Laser. Wir haben ein Ratengleichungsmodell<br />
entwickelt, das die Modendynamik eines Festkörperlasers mit<br />
einer beliebigen Zahl der angeregten Moden und Polarisationen und mit<br />
einer beliebigen Länge des Verstärkers im Resonator simulieren kann.<br />
Die numerischen Lösungen beschreiben sehr gut die Modendynamik<br />
eines Vielmodenlasers und zeigen u.a., dass die Frequenz der Hauptrelaxationsoszillationen<br />
von dem bekannten Wert für Einmodenlaser [1]<br />
stark abweichen kann. Regelung der Pumpleistung erlaubt eine deutliche<br />
Reduzierung des Emissionsrauschens des Lasers.<br />
[1] B. Peters, J. Hünkemeier, V. Baev, Y. Khanin, Phys. Rev. A 64,<br />
023816 (2001)<br />
Q 9.3 Mo 17:00 HS 218<br />
All solid-state intra-cavity Raman-Laser bei 1.53 µm —<br />
•Karsten Scholle, Eugen Osiac, Ernst Heumann und Günter<br />
Huber — Institut für Laser-Physik, Universität Hamburg, Luruper<br />
Chaussee 149, 22761 Hamburg, Germany<br />
Nichtlineare Frequenzkonversion mittels stimulierter Raman-Streuung<br />
(SRS) ist eine gute und effiziente Möglichkeit mit vorhandenen Lasern<br />
neue Wellenlängenbereiche zu erschließen.<br />
Wir zeigen einen im Rahmen des EU-Projektes I-WAKE realisierten<br />
intra-cavity Raman-Laser bei 1.55µm. Dazu wird ein BaWO4-Kristall<br />
in einen akusto-optisch gütegeschalteten Nd:YAG Laser eingefügt. Der<br />
verwendete Nd:YAG Laser wird mit einer fasergekoppelten Laserdiode<br />
bei 808nm angeregt und emittiert bei 1.36µm. Der Laser erreicht bei<br />
einer Wiederholrate von 500Hz und einer Auskopplung von 11.5% eine<br />
Pulsenergie von 1mJ bei einer Pulsbreite von 180ns. Mit dem BaWO4-<br />
Kristall in einem Resonator ohne Auskopplung bei 1.36µm wird SRS bei<br />
1.55µm beobachtet, wobei die Raman-Pulse eine Breite von 60ns aufweisen.<br />
Im Vortrag wird insbesondere über die Optimierung der Parameter<br />
des Raman-Lasers bei Anregungsbreiten von mehreren 100ns (notwendig<br />
für die Messtechnik des LIDAR-Projektes) berichtet.<br />
84<br />
Q 9.4 Mo 17:15 HS 218<br />
Leistungsskalierung von Faserverstärkern durch kohärentes<br />
Koppeln — •Sven Höfer, Holger Zellmer und Andreas<br />
Tünnermann — Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für<br />
Angewandte Physik, Max-Wien-Platz 1, 07743 Jena<br />
Schmalbandige Lichtquellen finden breite Anwendung in der Kommunikationstechnik,<br />
Spektroskopie und als Pumpquellen für die Frequenzkonversion.<br />
Höhere Ausgangsleistungen im Bereich über 100W bei beugungsbegrenzter<br />
Strahlqualität lassen sich mittels faserbasierten MOPA–<br />
Systemen sehr einfach, kostengünstig und kompakt realisieren. Bei Verwendung<br />
von aktiv dotierten Single–Mode–Fasern ist man allerdings<br />
durch das Auftreten von nichtlinearen Effekten, hauptsächlich stimulierter<br />
Brillouinstreuung (SBS), in der Ausgangsleistung begrenzt. Die Verwendung<br />
von Large–Mode–Area (LMA) Fasern erlaubt neben anderen<br />
Techniken eine Leistungsskalierung durch Erhöhung der Brillouinschwelle.<br />
Der parallele Einsatz mehrerer Verstärker macht es weiterhin möglich,<br />
mittels der Methode des kohärenten Koppelns, das Auftreten von SBS<br />
weiter zu größeren Leistungen hin zu verschieben.<br />
Der verwendete Mach–Zehnder–Aufbau dient zur Kopplung je zweier<br />
Verstärker, die sich in den Armen des Interferometers befinden. Ein monolithischer<br />
Ringlaser wird als Signalquelle mit Emission bei 1064 nm<br />
verwendet. Die Phasendifferenz zwischen zwei Verstärkern wird durch<br />
eine Regelelektronik in Seitenbandtechnik mittels elektrooptischer Phasenmodulatoren<br />
korrigiert. Details zum Aufbau, zur erfolgten Leistungsskalierung<br />
und zur Verstärkung und Regelung werden vorgestellt.<br />
Q 9.5 Mo 17:30 HS 218<br />
Inkohärente Kopplung von Halbleiterlaserbarren — • Andreas<br />
Jechow, Volker Raab und Ralf Menzel — Universität Potsdam,<br />
Institut für Physik/Lehrstuhl Photonik, Am Neuen Palais 10 14469 Potsdam<br />
Halbleiterlaserbarren besitzen hohe Ausgangsleistungen bei sehr gutem<br />
Wirkungsgrad und kleinen Abmessungen. Jedoch sind sie aufgrund<br />
ihrer schlechten Strahlqualität für bestimmte Anwendungen (z.B. Mikro-<br />
Materialbearbeitung, Drucktechnik) ungeeignet.<br />
Hier wird ein externer Resonator für einen 25 Emitter-Breitstreifen-<br />
Laserbarren (die Frontfacette ist AR-beschichtet) vorgestellt. Mit Hilfe<br />
von Beugungsgittern werden die Emitter einzeln frequenzstabilisiert,<br />
inkohärent gekoppelt und danach zu einem Strahl zusammenführt. Das<br />
Verfahren kann am ehesten als “Wavelength-Multiplexing” im Resonator<br />
beschrieben werden.<br />
Der Resonator setzt sich im Wesentlichen aus einem FAC zur Kollimation<br />
der “fast-axis”, 2 Zylinderlinsen und 2 Reflexionsgittern, die im<br />
Littrow-Aufbau angeordnet sind, zusammen.<br />
Es werden cw-Ausgangsleistungen von 10W bei M2 slow < 12 und<br />
M 2 fast<br />
< 3 bei einer Bandbreite von 15nm erreicht. Das entspricht ei-<br />
ner 40-fachen Verbesserung der “Brightness” gegenüber dem Laserbarren<br />
ohne externen Resonator (40W bei M 2 ≈ 2000).<br />
Q 9.6 Mo 17:45 HS 218<br />
Time-varying elliptically polarized states in vertical-cavity<br />
surface-emitting lasers — Markus Sondermann 1 , •Thorsten<br />
Ackemann 1 , Salvador Balle 2 , and Josep Mulet 2 — 1 Institut<br />
für Angewandte Physik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster,<br />
Corrensstr. 2-4, 48149 Münster, Germany — 2 Instituto Mediterráneo<br />
de Estudios Avanzados (IMEDEA), Universitat de les Illes Balears,<br />
E-07071 Palma de Mallorca, Spain<br />
The polarization dynamics of vertical-cavity surface-emitting lasers<br />
(VCSELs) has been debated intensively over the past years. In this contribution,<br />
we focus on elliptically polarized time-varying, i.e. dynamical<br />
states (DS). These states occur in the vicinity of a polarization switching<br />
(PS) event from the fundamental polarization mode with the longer<br />
wavelength to the mode with shorter wavelength and orthogonal linear<br />
polarization [1,2].<br />
The properties of these states are studied experimentally and theoretically<br />
in dependency on parameters (current and ambient temperature)<br />
and strain conditions. A direct manifestation of the DS in the time domain<br />
is found by oscillations of the polarization components at a frequency<br />
of a few gigahertz. For the theoretical interpretation an extended<br />
version of the so-called spin-flip model is used, which takes into account<br />
explicitly the spin degrees of freedom of the light field and of carriers in