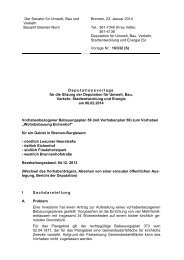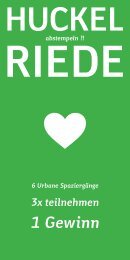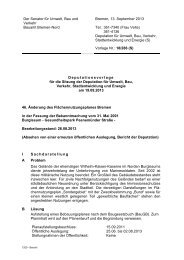Studie zur kapazitiven Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes im ...
Studie zur kapazitiven Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes im ...
Studie zur kapazitiven Leistungsfähigkeit des Eisenbahnnetzes im ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapazitive <strong>Leistungsfähigkeit</strong> <strong>des</strong> <strong>Eisenbahnnetzes</strong> <strong>im</strong> Großraum Bremen 230<br />
dann bei ~35 km/h einpendeln dürfte. Hierauf wird sich voraussichtlich kaum<br />
ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aus wirtschaftlich nachvollziehbaren<br />
Gründen einlassen können beziehungsweise wollen.<br />
Im Mischbetrieb wird der „Gz 1500“ nur dann in „akzeptabler“ Form produziert<br />
werden können, wenn dem konkurrierenden Schienenpersonenfernverkehr der<br />
Taktverkehrs-Vorrang bei Verspätungen genommen wird und er – ganz allgemein<br />
formuliert – seine Fahrpläne einhält. Damit wiederum würde es möglich<br />
werden, dass der Wagenladungsverkehr eine Transportgeschwindigkeit von<br />
ungefähr 85 und Containerzüge etwa 105 km/h erreicht.<br />
Prinzipiell wäre es natürlich möglich, den Personenfern- und Schienengüterverkehr<br />
auf verschiedenen Strecken fahren zu lassen (räumliche Entmischung),<br />
damit sie sich betrieblich nicht „ins Gehege kommen“. Für diesen Fall kann allerdings<br />
eine wesentlich preiswertere Lösung gewählt werden: Die Umsetzung<br />
der Betriebsstrategie „Netz 21“, die 1994 vom Vorstand der DB AG als „Bahn<br />
<strong>des</strong> 21. Jahrhunderts“ verkündet, die jedoch nie umgesetzt wurde. Danach wären<br />
vom 36.000 km langen Netz der DB Netz etwa 5.000 km zum Vorrangnetz<br />
für den Schienengüterverkehr („Güternetz“) erklärt worden. Auf diesem, die<br />
ganze Republik erschließenden Netz sollten alle Züge mit Durchschnittsgeschwindigkeiten<br />
zwischen 85 und 105 km/h fahren. Es hätte so gut wie keine<br />
Überholungen von Zügen gegeben. Nur wenige Überholgleise (für den Notfall)<br />
wären erforderlich. Der Schienengüterverkehr könnte nach dieser Konzeption<br />
Tag und Nacht „7/24“ ungestört und mit hoher Produktivität fließen. Außer einer<br />
Reihe lokaler Anpassungsmaßnahmen (die jeweils nach Bauabschluss unverzüglich<br />
in Betrieb gehen können) wären lediglich drei große Vorhaben zu realisieren:<br />
- Entlastung der rechten Rheinstrecke,<br />
- Installation eines leistungsfähigen Signal- und Zugsteuerungssystems und<br />
- Bau <strong>des</strong> Frankenwaldtunnels.<br />
Mit diesem Netz ließe sich – ohne nennenswerte Beeinträchtigung <strong>des</strong> Reiseverkehrs<br />
– nachweislich das vier- bis fünf-fache der heutigen Güterverkehrsleistung<br />
bewältigen, ohne dass es hierfür eines „GZ 1500“ bedarf.<br />
Fasst man vorstehende Überlegungen zusammen, so sind dem Projekt „Gz<br />
1500“ doch nur geringe Realisierungschancen ein<strong>zur</strong>äumen. 196 Unter Abwägung<br />
aller weiteren Aspekte, die vorstehend bereits skizziert wurden, erscheint<br />
es angebracht, alle Forschungs- und Finanzierungsressourcen für die Entmischung<br />
<strong>des</strong> Betriebs und damit dem sukzessiven Aufbau eines Güternetzes zu<br />
widmen.<br />
196<br />
Das ebenfalls vom BMWI geförderte Projekt „GZ 1000“ mit 1.000 m langen Zügen macht unter den<br />
oben geschildert Umständen überhaupt keinen Sinn, da es nahezu den gleichen Aufwand an Fahrzeugen<br />
und Infrastruktur erfordert, aber nur einen Bruchteil an (vermeintlichem) Produktivitätsgewinn<br />
einbringt.