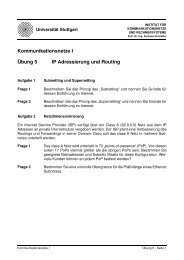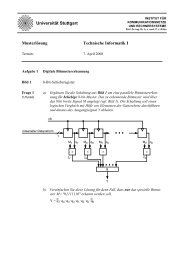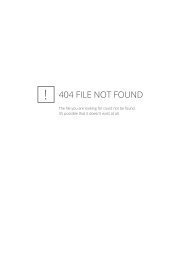Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
– 136 –<br />
teile auf. Dies bedeutet insbesondere, dass Verdrängung im Fall eines hohen Angebots an priorisiertem<br />
Verkehr ein vollständiges Aushungern in den Klassen mit geringer Priorität bewirken<br />
kann. Wie in [160] gezeigt wird, ist außerdem die Implementierung des Verdrängungsmechanismus<br />
im Vergleich zu den beiden anderen klassischen Puffermanagementverfahren deutlich<br />
komplexer. Allerdings wiegt dieser Nachteil angesichts der heute gegebenen Möglichkeiten,<br />
auch komplexere Algorithmen in Hardware zu realiseren, nicht mehr so schwer [60].<br />
Schwellwertverfahren<br />
Das Schwellwertverfahren stellt in doppelter Hinsicht einen Kompromiss zwischen Puffertrennung<br />
<strong>und</strong> Verdrängung dar. Zum einen ist es in Bezug auf Komplexität zwischen den beiden<br />
anderen Verfahren einzustufen. Zum anderen garantiert es im Gegensatz zur Puffertrennung<br />
zumindest im statistischen Sinn eine Besserstellung der Klasse mit höherem Schwellwert,<br />
ohne dass Pakete mit niedriger Priorität bei Ressourcenknappheit völlig aus dem Puffer verdrängt<br />
werden. Allerdings hängt das konkrete Verhalten sehr stark von den Schwellwerten in<br />
den einzelnen Klassen ab, sodass auch hier bei unbekannter Lastverteilung <strong>und</strong> Verkehrscharakteristik<br />
sowohl absolute Verluste als auch das Verhältnis der Verlustwahrscheinlichkeiten<br />
kaum vorhersehbar sind. Die Zusammenhänge sind noch schwieriger zu beherrschen, wenn<br />
eine teilweise gemeinsame Nutzung des Puffers mit unterschiedlichen Schwellwerten zusammen<br />
mit einem differenzierenden Scheduling eingesetzt wird [118].<br />
5.4.2.2 Verfahren auf der Basis von RED<br />
Im Kontext von IP-Netzen haben RED-basierte Puffermanagementverfahren große Beachtung<br />
gef<strong>und</strong>en. Geht es dabei um eine differenzierte Behandlung, ist in erster Linie das in Abschnitt<br />
3.2.1.2 vorgestellte WRED zu nennen, bei dem die Parameter min th, i , max th, i <strong>und</strong> max pi , in<br />
den einzelnen Klassen unterschiedliche Werte annehmen können. Eine proportionale Verlustdifferenzierung<br />
kann mit WRED näherungsweise erreicht werden, indem <strong>für</strong> min th,<br />
i <strong>und</strong><br />
max th, i in allen Klassen identische Werte gewählt <strong>und</strong> nur <strong>für</strong> max pi , unterschiedliche Werte<br />
gesetzt werden [38]. Für das Verhältnis der Verwerfungswahrscheinlichkeiten erhält man dann:<br />
p i<br />
----<br />
p j<br />
=<br />
max<br />
---------------- pi ,<br />
max p,<br />
j<br />
(5.16)<br />
Voraussetzung da<strong>für</strong> ist allerdings, dass <strong>für</strong> die Schwellenparameter ebenso wie <strong>für</strong> weitere<br />
RED-Parameter (z. B. die Gewichtung bei der Mittelwertbildung in Bezug auf die Warteschlangenlänge)<br />
angemessene Werte eingesetzt werden. Die idealen Werte hier<strong>für</strong> hängen u. a.<br />
von der Puffergröße sowie der Charakteristik des Verkehrs ab.<br />
Ein großer Vorteil von WRED ist seine weite Verbreitung <strong>und</strong> Bekanntheit, die dazu geführt<br />
haben, dass es bereits heute in vielen Routern implementiert ist. Allerdings zielen REDbasierte<br />
Verfahren in erster Linie auf TCP-Verkehr ab, wobei Untersuchungen in der Literatur