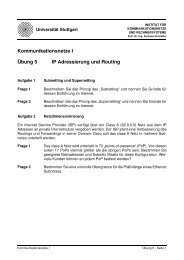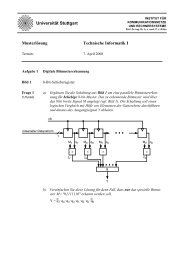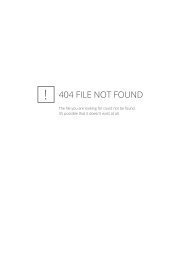Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
– 43 –<br />
3.2.4 Verwaltung von Netzressourcen<br />
Bei der in diesem Abschnitt behandelten Netzressourcenverwaltung (network resource management)<br />
geht es hauptsächlich um die Verwaltung von Bandbreite auf Verbindungsabschnitten.<br />
Sie unterscheidet sich von der in Anschnitt 3.2.1.1 vorgestellten Art der Bandbreitenverwaltung<br />
durch die Betrachtung der Verbindungsebene 6 anstelle der Paketebene. Gleichzeitig<br />
sind in der Regel mehrere Netzknoten betroffen, wodurch die Verbindung zur Verkehrslenkung<br />
hergestellt wird.<br />
Netzressourcenmanagement ist eng verknüpft mit der Verbindungsannahmesteuerung (siehe<br />
Abschnitt 3.2.3) im Fall von mehreren Klassen, wobei es sich dabei um Dienstgüteklassen oder<br />
um andere Formen von Aggregaten handeln kann (siehe Abschnitt 3.1.5). Im Wesentlichen<br />
geht es darum, die auf den Verbindungsleitungen zur Verfügung stehende Bandbreite so aufzuteilen,<br />
dass einerseits die Dienstgüteanforderungen auf der Paketebene (z. B. Paketverlustwahrscheinlichkeiten)<br />
eingehalten werden <strong>und</strong> andererseits die Leistung auf der Verbindungsebene,<br />
ausgedrückt durch die Blockierwahrscheinlichkeit, bestimmten Kriterien genügt. Bei<br />
der Formulierung dieser Kriterien steht wieder das gesamte Spektrum von Garantien (siehe<br />
Abschnitt 3.1.4) zur Auswahl, von der Gleichberechtigung aller Klassen auf der Verbindungsebene<br />
als Ziel über eine proportionale Abstufung von Blockierungswahrscheinlichkeiten bis<br />
hin zu festen Obergrenzen <strong>für</strong> die Blockierung in einzelnen Klassen. Die Umsetzung der Kriterien<br />
erfolgt jedoch nicht auf direktem Weg, sondern durch eine – möglicherweise dynamische<br />
– Zuweisung von Bandbreiteanteilen (bandwidth allocation), wo<strong>für</strong> verschiedene Verfahren<br />
existieren.<br />
Eine einfache Strategie stellt die gemeinsame Nutzung (complete sharing) der gesamten Bandbreite<br />
dar, die dann allen Klassen gleichberechtigt zur Verfügung steht. Auf die resultierenden<br />
Blockierungswahrscheinlichkeiten, die in diesem Fall in Klassen mit strengeren Dienstgüteanforderungen<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich höher ausfallen, kann kein Einfluss genommen werden [148].<br />
Dem gegenüber steht die komplette Partitionierung (complete partitioning) der zur Verfügung<br />
stehenden Bandbreite. Dabei erfolgt eine feste Zuweisung von Anteilen an der Gesamtbandbreite<br />
an die einzelnen Klassen. Hat eine Klasse ihren Bandbreiteanteil ausgeschöpft, müssen<br />
weitere Verbindungen abgewiesen werden; der Effekt des statistisches Multiplexens zwischen<br />
Klassen bleibt also ungenutzt. Derartige Verfahren sind eng an Strategien zur Reservierung<br />
von Verbindungsleitungen (trunk reservation) in Netzen mit Durchschaltevermittlung angelehnt.<br />
Eine hybride Form des Bandbreitenmanagements ist die teilweise gemeinsame Nutzung<br />
(partial sharing), bei der wie im Fall der kompletten Partitionierung gewisse Bandbreiteanteile<br />
exklusiv <strong>für</strong> die einzelnen Klassen reserviert sind, daneben aber auch noch ein Bandbreitean-<br />
6 Zum Verbindungsbegriff in IP-Netzen siehe die entsprechenden Anmerkungen in Abschnitt 3.2.3.