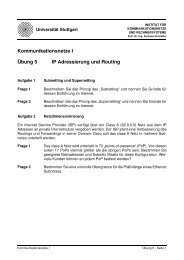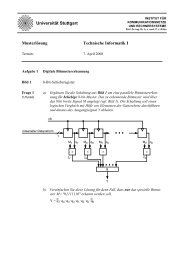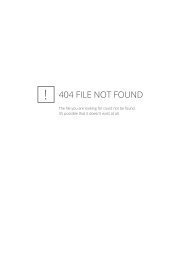Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– 45 –<br />
Die meisten Verfahren innerhalb beider Gruppen berücksichtigen nur die Zieladresse von IP-<br />
Paketen (destination-based routing) als Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> eine abschnittsweise Festlegung des<br />
Weges (hop-by-hop routing). Im einfachsten Fall orientiert sich das Verfahren bei dieser Entscheidung<br />
ausschließlich an der Netztopologie, indem der kürzeste Weg (shortest path) auf<br />
Basis der Anzahl zwischen Quelle <strong>und</strong> Ziel liegender Abschnitte (hop count) bestimmt wird.<br />
Darüber hinaus gibt es Verfahren, die bei der Bestimmung des „kürzesten“ Weges eine<br />
Gewichtung der einzelnen Abschnitte vornehmen, z. B. mit der auf diesem Abschnitt gemessenen<br />
Verzögerung. In diesem Fall ist das Verkehrslenkungsverfahren in der Lage, sich der gegebenen<br />
Lastsituation anzupassen <strong>und</strong> Pakete über weniger belastete Abschnitte zu leiten (adaptive<br />
Verkehrslenkung). Andererseits neigen solche Verfahren zur Erzeugung von Oszillationen.<br />
Für die Ermittlung des kürzesten Weges sowie die dazu erforderliche Verteilung von Informationen<br />
zwischen Routern gibt es wiederum verschiedene Möglichkeiten. Ältere Verfahren wie<br />
das Routing Information Protocol (RIP) [123, 184] aus der Gruppe der IGP-Verfahren beruhen<br />
auf der Verwendung von Distanzvektoren (distance vectors) in den einzelnen Routern, die als<br />
Elemente jeweils die Entfernungen (als Hop Count oder in gewichteter Form) zu allen anderen<br />
Routern enthalten. Der Distanzvektor eines Routers „A“ wird in periodischen Abständen an<br />
alle benachbarten Router von „A“ weitergereicht. Die Nachbarn überprüfen dann <strong>für</strong> jeden<br />
Weg, der über „A“ führt, ob sich die Distanz zum Zielknoten geändert hat, <strong>und</strong> passen ggf. die<br />
Entfernungswerte in ihrem Distanzvektor an. Wird außerdem festgestellt, dass sich die Distanz<br />
verringert, wenn der Weg zu einem bestimmten Ziel über „A“ anstatt über einen anderen Router<br />
geführt wird, erfolgt eine entsprechende Aktualisierung der Verkehrslenkungstabelle sowie<br />
des Distanzvektors, der wiederum an alle Nachbarn verschickt wird. Diese Vorgehensweise ist<br />
jedoch mit einigen Problemen verb<strong>und</strong>en, z. B. der Gefahr der Entstehung von Schleifen.<br />
Diese Probleme verschärfen sich mit zunehmender Größe des Netzes, sodass diese Klasse von<br />
Verfahren als kritisch im Hinblick auf Skalierbarkeit gilt.<br />
Eine Alternative zur Verwendung von Distanzvektoren bieten die so genannten Link-State-Protokolle.<br />
Dabei sendet jeder Router Informationen über den Status der von ihm ausgehenden<br />
Abschnitte (links) an die anderen Router innerhalb der Domäne, die dadurch eine vollständige<br />
Sicht der Netztopologie erhalten. Auf dieser Basis kann dann jeder Router den kürzesten Weg<br />
zu jedem beliebigen Ziel innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Verkehrslenkungsprotokolls<br />
bestimmen, z. B. mit Hilfe des Algorithmus von Dijkstra. Der bekannteste Vertreter dieser<br />
Klasse von Verkehrslenkungsverfahren in IP-Netzen ist das OSPF-Protokoll (open shortest<br />
path first) aus der Gruppe der IGP-Verfahren [199]. Es bietet neben der Gewichtung von<br />
Abschnitten bei der Wegberechnung mit einer aus der Verzögerung abgeleiteten Größe auch<br />
Einsatzmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Verkehrsdifferenzierung.