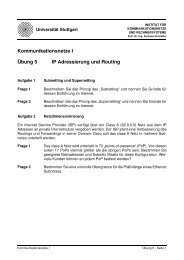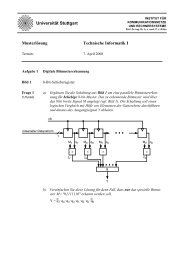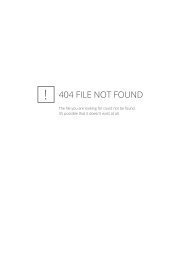Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– 3 –<br />
Kapitel 3 beschäftigt sich allgemein mit Mechanismen <strong>und</strong> Architekturen zur Dienstgüteunterstützung<br />
<strong>und</strong> ermöglicht so eine Einordnung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verfahrens.<br />
Zunächst werden dabei einige gr<strong>und</strong>legende Merkmale im Zusammenhang mit dem<br />
Begriff der Dienstgüte identifiziert. Anschließend erfolgt eine Vorstellung der verschiedenen<br />
Verkehrsmanagement-Funktionen, die innerhalb von Dienstgüte unterstützendenen Architekturen<br />
eine Rolle spielen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Klassifikation <strong>und</strong> Beschreibung<br />
von Scheduling- <strong>und</strong> Puffermanagementmechanismen. Darauf aufbauend werden die wichtigsten<br />
Ansätze <strong>und</strong> Architekturen zur Bereitstellung von Dienstgüte in IP-Netzen präsentiert.<br />
Insbesondere wird gezeigt, wie die einzelnen Verkehrsmanagement-Funktionen darin zur<br />
Anwendung kommen.<br />
Im vierten Kapitel geht es um die Modellierung von IP-Netzen vor dem Hintergr<strong>und</strong> einer<br />
Leistungsbewertung von Systemen <strong>und</strong> Verfahren. Es erfolgt zuerst eine Gegenüberstellung<br />
verschiedener Untersuchungsmethoden <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Anforderungen <strong>und</strong><br />
Schwierigkeiten im Kontext von IP-Netzen. Eine große Herausforderung bei der Untersuchung<br />
stellt die in Messungen beobachtete Langzeitabhängigkeit von IP-Verkehr <strong>und</strong> das damit verb<strong>und</strong>ene<br />
Phänomen der Selbstähnlichkeit dar. Dies muss auch bei der Verkehrsmodellierung<br />
berücksichtigt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Modellierung von IP-Verkehr ist<br />
die Adaptivität des erzeugten Verkehrs an den aktuellen Netzzustand. Diese ergibt sich aus der<br />
Verwendung des in IP-Netzen überwiegend als Transportprotokoll eingesetzten Transmission<br />
Control Protocol (TCP). Im Hinblick auf die Modellierung erfordert dies eine Berücksichtigung<br />
der TCP-Mechanismen zur Fluss- <strong>und</strong> Überlaststeuerung <strong>und</strong> weiterer Eigenschaften<br />
dieses Protokolls. Darüber hinaus gilt es aber auch, ebenso einfache wie repräsentative<br />
Modelle <strong>für</strong> den Verkehr zu finden, der von den auf TCP aufsetzenden Anwendungen erzeugt<br />
wird. Gleiches gilt <strong>für</strong> den von Multimedia-Anwendungen generierten Echtzeitverkehr.<br />
Schließlich werden in Kapitel 4 eine Reihe von Leistungsmetriken vorgestellt, die <strong>für</strong> eine<br />
Beurteilung in Frage kommen <strong>und</strong> an denen sich auch Verfahren des Verkehrsmanagement orientieren<br />
müssen. Dabei findet wie im Fall der Verkehrsmodellierung eine Betrachtung auf<br />
unterschiedlichen Ebenen statt.<br />
Aufbauend auf der Klassifikation von Scheduling- <strong>und</strong> Puffermanagementverfahren in<br />
Kapitel 3 wird in Kapitel 5 ein Verfahren vorgeschlagen, das eine relative Differenzierung von<br />
Verkehrsströmen innerhalb eines IP-Netzknotens ermöglicht. Das Verfahren erlaubt zum einen<br />
die Formulierung unterschiedlicher Verzögerungsanforderungen. Zum anderen wird eine proportionale<br />
Differenzierung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeiten <strong>für</strong> die Überschreitung vorgegebener<br />
Maximalverzögerungen vorgenommen, indem <strong>für</strong> die einzelnen Klassen unterschiedliche<br />
Gewichte vergeben werden. Damit ist es neben einer Unterscheidung von echtzeitkritischem<br />
<strong>und</strong> TCP-basiertem Verkehr auch möglich, innerhalb dieser beiden<br />
Verkehrsgruppen mehrere Klassen zu unterschieden. Auf Fragen im Zusammenhang mit der<br />
Realisierung des Verfahrens geht Kapitel 5 ebenso ein wie auf eine Reihe von Optionen, die