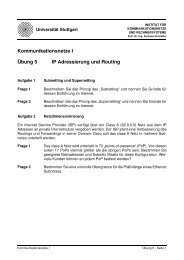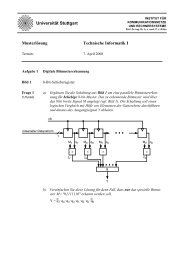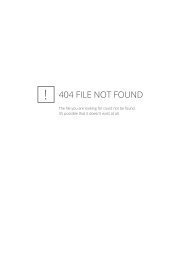Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– 155 –<br />
6.1.3.2 Sicherheitsabstand<br />
Ein Parameter, der in den bisherigen Untersuchungen unverändert geblieben ist, aber in einigen<br />
Szenarien bereits als wichtige Einflussgröße identifiziert werden konnte, ist der Sicherheitsabstanε<br />
i , bei dessen Unterschreiten ein Eintritt in den Überlastmodus stattfindet (siehe<br />
Abschnitt 5.3.2). Für die nachfolgenden Studien wird wieder ein WEDD-Scheduler zugr<strong>und</strong>e<br />
gelegt, der die LPD-Option verwendet <strong>und</strong> dabei zwei Klassen mit w 1 ⁄ w 0 = 10 differenziert.<br />
Zunächst wird der Sicherheitsabstand so variiert, dass das Verhältnis ε i ⁄ δ i in beiden Klassen<br />
gleich ist. Für ein Angebot von 0.95, gleiche Lastanteile in beiden Klassen <strong>und</strong> unterschiedliche<br />
Werte <strong>für</strong> δ i ergeben sich die in Bild 6.12 dargestellten Verwerfungswahrscheinlichkeiten.<br />
Diese sind über einen weiten Bereich nahezu unabhängig von ε i ⁄ δ i , wobei ein ganz leichter<br />
Anstieg in beiden Klassen zwischen ε i ⁄ δ i = 0.1 <strong>und</strong> ε i ⁄ δ i = 1 zu erkennen ist. Für sehr kleine<br />
Werte des Sicherheitsabstandes wird jedoch der Unterschied zwischen den Klassen immer<br />
geringer. Offensichtlich hängt dabei der Knickpunkt, ab dem das gewünschte Verhältnis von<br />
p 0 ⁄ p 1 = 10 näherungsweise erreicht wird, nicht von dem Verhältnis zur Maximalverzögerung<br />
ab.<br />
Bild 6.13 zeigt daher die Ergebnisse einer Untersuchung mit gleichem, von δ i unabhängigen<br />
Sicherheitsabstand in beiden Klassen. Hier ergibt sich ein fast identischer Verlauf von p 0 ⁄ p 1<br />
<strong>für</strong> unterschiedliche Werte der Maximalverzögerungen. Die Untersuchung wurde dabei nicht<br />
nur <strong>für</strong> das Verkehrsszenario V A , sondern auch <strong>für</strong> Szenario V D durchgeführt, bei dem Pakete<br />
mit einer Länge von 1000 Byte (anstelle von L = 200 Byte bei V A ) bei gleicher Burstgröße<br />
<strong>und</strong> Spitzenrate erzeugt werden. Die Auftragung der relativen Verwerfungswahrscheinlichkeiten<br />
in Bild 6.13 erfolgt daher über einem Sicherheitsabstand, dessen Wert auf die Paketbe-<br />
Verwerfungswahrscheinlichkeit<br />
10 -1<br />
Klasse 0<br />
10 -2<br />
δ 0<br />
= 10 ms, δ 1<br />
= 5 ms<br />
δ 0<br />
= 20 ms, δ 1<br />
= 10 ms<br />
δ 0<br />
= 40 ms, δ 1<br />
= 20 ms<br />
Klasse 1<br />
10 -3<br />
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1<br />
relativer Sicherheitsabstand (ε i<br />
/ δ i<br />
)<br />
Verhältnis der Verwerfungswahrscheinlichkeiten (p 0 / p 1 )<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
δ 0 = 10 ms, δ 1 = 5 ms<br />
2<br />
δ 0 = 20 ms, δ 1 = 10 ms<br />
δ 0 = 40 ms, δ 1 = 20 ms<br />
0<br />
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5<br />
Sicherheitsabstand / Paketbedienzeit (ε i / (L / C))<br />
Bild 6.12: Absolute Verwerfungswahrscheinlichkeiten<br />
über ε i<br />
Bild 6.13: Relative Verwerfungswahrscheinlichkeiten<br />
über ε i<br />
⁄ δ i<br />
⁄ ( L ⁄ C)<br />
(V A , A = 0.95, m 1<br />
= m 0<br />
)<br />
(gefüllt: V A , offen: V D , A = 0.95, m 1<br />
= m 0<br />
)