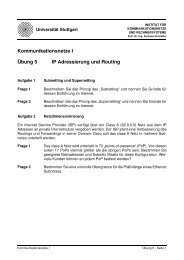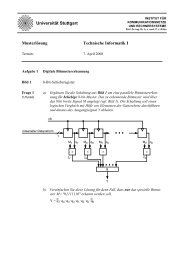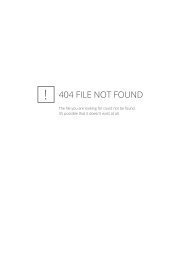Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Institut für Kommunikationsnetze und Rechnersysteme - Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
– 152 –<br />
= 16 s weitgehend konstant entspre-<br />
laufen, d. h. das Verhältnis bleibt selbst im Fall von<br />
chend dem voreingestellten Wert w 0 ⁄ w 1 = 10.<br />
∆t<br />
Wird das System bei einem Angebot von 0.8 betrachtet, stellt man fest, dass die relativen<br />
Schwankungen <strong>für</strong> beide Intervallbreiten deutlich zunehmen. Allerdings muss beachtet werden,<br />
dass die Verwerfungswahrscheinlichkeiten hier insgesamt um eine Größenordnung niedriger<br />
ausfallen. Dies ist auch der Gr<strong>und</strong> da<strong>für</strong>, dass innerhalb von Intervallen der Länge<br />
∆t = 16 s kein konstantes Verhältnis der Verwerfungshäufigkeiten mehr erzielt werden kann.<br />
Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Unzulänglichkeit von WEDD, sondern angesichts<br />
einer langfristigen Verwerfungswahrscheinlichkeit im Bereich von 10 – 4 <strong>für</strong> Klasse 1 einerseits<br />
(vgl. Bild 6.3) <strong>und</strong> im Mittel 4 ⋅ 10 4 ankommenden Paketen pro Klasse innerhalb von 16 s<br />
andererseits ist es aufgr<strong>und</strong> der Verkehrsschwankungen nicht verw<strong>und</strong>erlich, wenn es eine<br />
beträchtliche Anzahl von Intervallen gibt, in denen überhaupt kein Paket aus Klasse 1 verworfen<br />
wird. Bei solch geringen Verwerfungswahrscheinlichkeiten ist es also prinzipiell durch die<br />
geringe Granularität der Häufigkeiten nahezu unmöglich, in kleinen Intervallen ein bestimmtes<br />
Verlustverhältnis zu gewährleisten. Wird die Intervallbreite hingegen größer gewählt (z. B.<br />
128 s in Bild 6.7), so kann auch wieder bei A = 0.8 ein paralleler Verlauf der Kurven <strong>für</strong> die<br />
Verlusthäufigkeiten beobachtet werden.<br />
6.1.3 Einfluss von WEDD-Optionen <strong>und</strong> Systemparametern<br />
Die Umsetzung von WEDD bietet eine Reihe von Freiheitsgraden, z. B. im Hinblick auf<br />
Optionen wie das Verwerfen von verspäteten Paketen (LPD) oder den Einsatz des CSA-<br />
Mechanismus oder bzgl. der Wahl von Parametern wie Sicherheitsabstand, Puffergröße oder<br />
Abschätzungsverfahren der Überschreitungshäufigkeiten (siehe Abschnitt 5.3). Der Einfluss<br />
dieser Optionen <strong>und</strong> Parameter wird in diesem Abschnitt untersucht.<br />
6.1.3.1 Verwerfen von verspäteten Paketen<br />
Die bisherigen Untersuchungen verwendeten das WEDD-Verfahren in der Version, bei der verspätete<br />
Pakete, die zur Abarbeitung anstehen, verworfen werden (LPD, siehe Abschnitt 5.3.1).<br />
Hier soll nun ein Vergleich mit einem WEDD-System mit zwei Klassen stattfinden, das auf<br />
diese Option verzichtet.<br />
Zunächst werden die Fristüberschreitungswahrscheinlichkeiten, die im Fall von WEDD mit<br />
LPD gleichbedeutend mit den Verwerfungswahrscheinlichkeiten sind, wieder <strong>für</strong> ein konstantes<br />
Gesamtangebot A = 0.95 über dem Verhältnis der mittleren Datenraten m 1 ⁄ m 0 aufgetragen<br />
(Bild 6.8). Dabei zeigt sich zum einen, dass die Fristüberschreitungswahrscheinlichkeiten<br />
deutlich höher sind als im Fall mit LPD. Dies liegt daran, dass bei WEDD ohne LPD verspätete<br />
Pakete Bandbreiteressourcen belegen, sodass andere Pakete warten müssen <strong>und</strong> dadurch<br />
selbst ihre Frist überschreiten. In dem Fall, dass Pakete bei Verspätung im Endgerät ohnehin