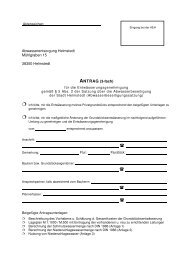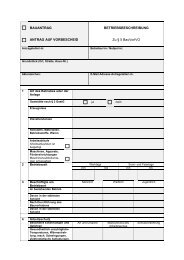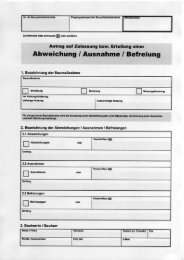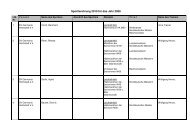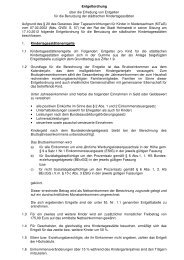Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 NATUR UND LANDSCHAFT<br />
Auf den ersten Blick zeigen sie Verwahrlosung an, sind Müllablagerungsplätze und Schandflecke,<br />
auf den zweiten Blick stellen sie die natürlichsten Flächen in einer <strong>Stadt</strong> dar: Brachen.<br />
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Brachen integrierte und damit anerkannte Teile<br />
der Dreifelderwirtschaft. Im Zuge der Agrarreform ging ihr Flächenanteil zurück, da sie wegen<br />
der Verfügbarkeit mineralischer Dünger nicht mehr notwendig waren. Damit sank auch<br />
ihr Ansehen. Dieses änderte sich erst, als man den ökologischen Wert von Brachen erkannte.<br />
Brache ist kein bestimmter Zustand, sondern ein dynamischer Vorgang, der abhängig vom<br />
Standort und der bisherigen Nutzung recht unterschiedlich ablaufen kann. Auf fast allen Flächen<br />
jedoch würde sich ohne menschliche Eingriffe nach Durchlaufen verschiedener natürlicher<br />
Entwicklungsstufen ein Wald entwickeln.<br />
Auf Brachflächen in der <strong>Stadt</strong> entstehen oft Ruderalfluren. Das Wort „ruderal“ stammt vom<br />
lateinischen Wort „rudus“ ab und bedeutet „Schutt“. Auf frischen, nährstoffreichen Böden<br />
dominieren Brennnesseln, Giersch und Wiesenkerbel, auf den trockeneren Flächen kommen<br />
vor allem Steinklee, Rainfarn, Wilde Möhre und Natternkopf vor. Diese Pflanzen der trockeneren<br />
Flächen beeindrucken durch ihre Farbenvielfalt: sie gehören zu den buntesten Pflanzengesellschaften,<br />
die die Natur zu bieten hat.<br />
Diese Ruderalfluren stellen für die Tierwelt wichtige Nahrungsstätten dar. Zahlreiche Raupen<br />
und Tagschmetterlinge wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Admiral oder Landkärtchen leben<br />
von Brennnesseln und Disteln.<br />
Viele Blüten haben Anpassungen an die sie bestäubenden Insekten entwickelt. Ziel ist dabei<br />
eine möglichst effektive Übertragung des Polens von einer auf die andere Blüte. Käfer waren<br />
vermutlich die ersten Bestäuber in der Erdgeschichte. Da Käfer nicht sehr vorsichtig mit der<br />
Blüte umgehen, sind diese oft etwas robuster gebaut und bieten Nektar und Pollen frei zugänglich<br />
an.<br />
Blüten, die von Fliegen bestäubt werden, sind oft weiß, Braun oder schmutzig-gelb. Teilweise<br />
riechen sie für den Menschen unangenehm wie Efeu, Weißdorn oder Schwarzer Holunder.<br />
Bienenblumen besitzen oft eine Landemöglichkeit, der Nektar ist bei ihnen weniger tief in der<br />
Blüte verborgen als bei Blüten, die von Schmetterlingen bestäubt werden. Um Insekten anzulocken,<br />
haben einige Arten ganz raffinierte Mechanismen entwickelt: Der Aronstab besitzt<br />
zum Beispiel einen Kessel, in den die bestäubenden Insekten hinein stürzen und den sie erst<br />
nach erfolgter Bestäubung wieder verlassen können. Einige Orchideenblüten sind weiblichen<br />
Insekten sehr ähnlich, so dass die männlichen Artgenossen auf sie „fliegen“ und die Bestäubung<br />
damit sichern.<br />
<strong>Umweltbericht</strong> <strong>Helmstedt</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> 44