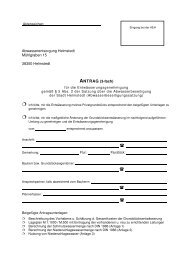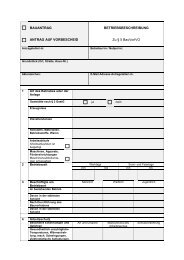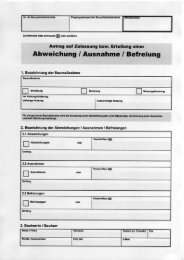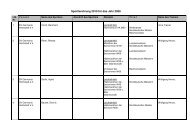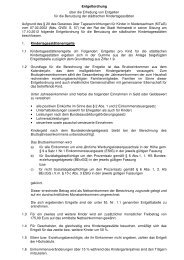Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 WASSER<br />
zählen z. B. Eschen, Ebereschen, Flatterulmen, Stieleichen, Rotbuchen und Traubenkirschen.<br />
In diesem Bereich sind außerdem noch typische Sträucher der Auenbereiche gepflanzt<br />
worden, u. a. Schneeball, Schwarzer Holunder und Haselnuss.<br />
Zur weiteren Erhöhung der Artenvielfalt sind im Bereich des Rückhaltebeckens zwei größere<br />
Vertiefungen angelegt worden, deren maximale Tiefe zum umliegenden Gelände bei ca. 100<br />
cm liegt. Entwicklungsziel war dabei nicht die Anlage von Teichen, sondern lediglich die<br />
Schaffung von wechselfeuchten Zonen, die zumindest eine längere Zeit des Jahres wassergefüllt<br />
sein sollten. Aufgrund der stauenden Eigenschaften des lehmig-tonigen Bodenmaterials<br />
weisen sie heute eine ständige Wasserfüllung auf. In ihrem Böschungsbereich sind<br />
gleichfalls Gehölze der Weichholzaue angepflanzt worden; zudem ist direkt am Ufer eine<br />
Initialpflanzung mit Rohrkolben, Schilf und Igelkolben ausgeführt worden.<br />
Die bauliche Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens erfolgte im Spätsommer 1994, und<br />
es hat sich bis heute planungsgerecht entwickelt. Dies drückt sich nicht zuletzt in der mittlerweile<br />
zu beobachtenden faunistischen Artenvielfalt aus.<br />
Die Umlegung des Grabens erfolgte mit der Zielrichtung, im Längs- und Querprofil weitestgehend<br />
einen Flachlandbach nachzuempfinden. Entsprechend der Höhenschichtlinien des<br />
Geländes sind daher im Längsverlauf mehrere „Bachschleifen“ (Mäander) angelegt worden,<br />
die sich natürlicherweise durch das Wechselspiel von Erosion und Ablagerung einstellen<br />
würden. In der heutigen Kulturlandschaft haben allerdings nur noch wenige Gewässer den<br />
Raum zu einer derartigen Entwicklung.<br />
Für die Ausbildung des Querprofils war der wesentliche Gesichtspunkt die Böschungsneigung.<br />
Diese sind so flach wie möglich ausgebildet worden (1:3 bis 1:5), sodass der Abflussquerschnitt<br />
neben dem Berechnungshochwasser auch noch Raum für einen natürlichen Gehölzsaum<br />
bietet. Unmittelbar an der Mittelwasserlinie sind dann Schwarzerlen und Weiden<br />
angepflanzt worden. Diese bieten einen optimalen Uferschutz und halten durch den Schattenwurf<br />
die Fließrinne krautfrei. Positiv ist auch deren Einfluss auf den Sauerstoffgehalt im<br />
Gewässer. Das Blätterdach ist in weiten Abschnitten bereits dicht geschlossen, so das die<br />
Auswirkungen der Beschattung mittlerweile gut beobachtet werden können. Im Rahmen der<br />
zukünftigen Gewässerunterhaltung werden die Gehölze der Weichholzaue abschnittsweise<br />
auf den Stock gesetzt bzw. als Kopfweiden entwickelt werden. Die Weiden- und Erlenruten<br />
können dann zur Begrünung weiterer städtischer Gewässer Verwendung finden.<br />
Auch die im Bereich des Grabens zwingend erforderlichen technischen Bauwerke sind im<br />
Rahmen einer ökologisch verträglichen Gesamtgestaltung - verglichen mit herkömmlichen<br />
Planungen - modifiziert worden. So ist die Betonsohle im Bereich der Straßenbrücke „Willi-<br />
<strong>Umweltbericht</strong> <strong>Helmstedt</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> 89