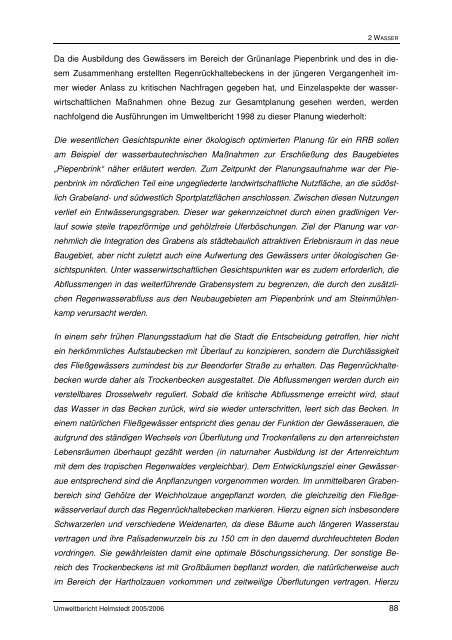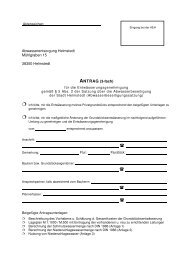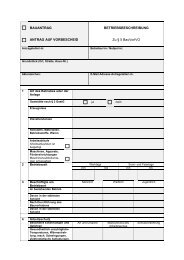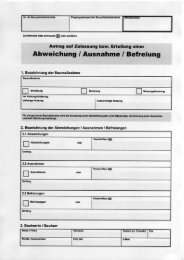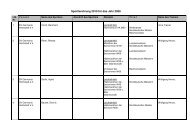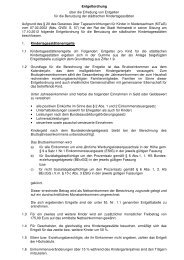Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 WASSER<br />
Da die Ausbildung des Gewässers im Bereich der Grünanlage Piepenbrink und des in diesem<br />
Zusammenhang erstellten Regenrückhaltebeckens in der jüngeren Vergangenheit immer<br />
wieder Anlass zu kritischen Nachfragen gegeben hat, und Einzelaspekte der wasserwirtschaftlichen<br />
Maßnahmen ohne Bezug zur Gesamtplanung gesehen werden, werden<br />
nachfolgend die Ausführungen im <strong>Umweltbericht</strong> 1998 zu dieser Planung wiederholt:<br />
Die wesentlichen Gesichtspunkte einer ökologisch optimierten Planung für ein RRB sollen<br />
am Beispiel der wasserbautechnischen Maßnahmen zur Erschließung des Baugebietes<br />
„Piepenbrink“ näher erläutert werden. Zum Zeitpunkt der Planungsaufnahme war der Piepenbrink<br />
im nördlichen Teil eine ungegliederte landwirtschaftliche Nutzfläche, an die südöstlich<br />
Grabeland- und südwestlich Sportplatzflächen anschlossen. Zwischen diesen Nutzungen<br />
verlief ein Entwässerungsgraben. Dieser war gekennzeichnet durch einen gradlinigen Verlauf<br />
sowie steile trapezförmige und gehölzfreie Uferböschungen. Ziel der Planung war vornehmlich<br />
die Integration des Grabens als städtebaulich attraktiven Erlebnisraum in das neue<br />
Baugebiet, aber nicht zuletzt auch eine Aufwertung des Gewässers unter ökologischen Gesichtspunkten.<br />
Unter wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten war es zudem erforderlich, die<br />
Abflussmengen in das weiterführende Grabensystem zu begrenzen, die durch den zusätzlichen<br />
Regenwasserabfluss aus den Neubaugebieten am Piepenbrink und am Steinmühlenkamp<br />
verursacht werden.<br />
In einem sehr frühen Planungsstadium hat die <strong>Stadt</strong> die Entscheidung getroffen, hier nicht<br />
ein herkömmliches Aufstaubecken mit Überlauf zu konzipieren, sondern die Durchlässigkeit<br />
des Fließgewässers zumindest bis zur Beendorfer Straße zu erhalten. Das Regenrückhaltebecken<br />
wurde daher als Trockenbecken ausgestaltet. Die Abflussmengen werden durch ein<br />
verstellbares Drosselwehr reguliert. Sobald die kritische Abflussmenge erreicht wird, staut<br />
das Wasser in das Becken zurück, wird sie wieder unterschritten, leert sich das Becken. In<br />
einem natürlichen Fließgewässer entspricht dies genau der Funktion der Gewässerauen, die<br />
aufgrund des ständigen Wechsels von Überflutung und Trockenfallens zu den artenreichsten<br />
Lebensräumen überhaupt gezählt werden (in naturnaher Ausbildung ist der Artenreichtum<br />
mit dem des tropischen Regenwaldes vergleichbar). Dem Entwicklungsziel einer Gewässeraue<br />
entsprechend sind die Anpflanzungen vorgenommen worden. Im unmittelbaren Grabenbereich<br />
sind Gehölze der Weichholzaue angepflanzt worden, die gleichzeitig den Fließgewässerverlauf<br />
durch das Regenrückhaltebecken markieren. Hierzu eignen sich insbesondere<br />
Schwarzerlen und verschiedene Weidenarten, da diese Bäume auch längeren Wasserstau<br />
vertragen und ihre Palisadenwurzeln bis zu 150 cm in den dauernd durchfeuchteten Boden<br />
vordringen. Sie gewährleisten damit eine optimale Böschungssicherung. Der sonstige Bereich<br />
des Trockenbeckens ist mit Großbäumen bepflanzt worden, die natürlicherweise auch<br />
im Bereich der Hartholzauen vorkommen und zeitweilige Überflutungen vertragen. Hierzu<br />
<strong>Umweltbericht</strong> <strong>Helmstedt</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> 88