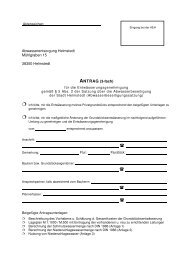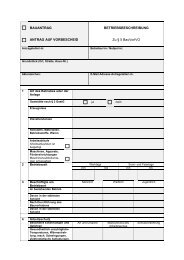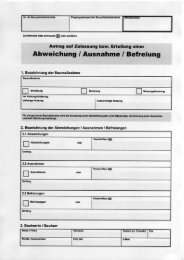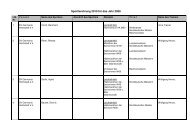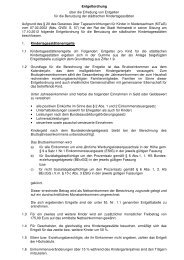Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Umweltbericht 2005/2006 - Stadt Helmstedt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 WASSER<br />
2.1.2 Stillgewässer<br />
Unter Stillgewässern werden alle Stehendwasserflächen - vom kleinsten Tümpel bis zum<br />
großen See - verstanden, denen ein nur langsamer Wasseraustausch gemeinsam ist. Ähnlich<br />
den Fließgewässern gehört diese Art von Feuchtbiotopen im naturnahen Zustand zu den<br />
biologisch reichhaltigsten und vielfältigsten Landschaftselementen, die unsere Landschaft<br />
hinsichtlich Wasserhaushalt, Kleinklima, Gestalt, biologischer Vielfalt und Erholungseignung<br />
entscheidend prägen. Künstlich angelegte Stillgewässer werden als Teiche bezeichnet, Gewässer<br />
natürlicher Entstehungsform hingegen als Weiher.<br />
Lage und Name der <strong>Helmstedt</strong>er Teiche sind der Karte 2/1 (Seite 78) zu entnehmen. Alle<br />
größeren <strong>Helmstedt</strong>er Stillgewässer sind künstlich angelegt worden. Die innerstädtischen<br />
Teiche sind zudem integraler Bestandteil des <strong>Stadt</strong>entwässerungssystem und hatten zumindest<br />
in der Vergangenheit auch eine Regenwasserrückhaltefunktion.<br />
Die Gewässergüte der Stillgewässer kann nicht mit den Bioindikatoren für Fließgewässer<br />
bestimmt werden, da es in Seen zur Ausbildung unterschiedlicher Wasserschichten kommen<br />
kann. Die einzelnen Schichten unterscheiden sich hinsichtlich chemischer (z.B. Sauerstoff)<br />
und physikalischer (z.B. Temperatur) Faktoren. Je nach Probenahmestelle hätte man im selben<br />
Gewässer zur selben Zeit unterschiedliche Ergebnisse. Stehende Gewässer werden<br />
deshalb nicht nach der Intensität der Abbauprozesse (Saprobie) sondern nach der Intensität<br />
der Produktion (Trophie) beurteilt. Da diese von der Konzentration der Nährstoffe abhängt,<br />
kann von der Produktion auf die Belastung des Gewässers geschlossen werden. Zur Festlegung<br />
des Trophiegrades werden das Ausmaß der Produktion (Planktonentwicklung), die<br />
Sauerstoffverteilung, die Sichttiefe und der Gewässergrund untersucht. Es erfolgt eine Einteilung<br />
in 4 Trophiestufen:<br />
Trophiestufe I, oligotroph - nährstoffarm.<br />
Durch die geringe Planktonproduktion weisen diese ganzjährig klaren Gewässer Sichttiefen<br />
von über 4 Metern auf. Die Ufer sind überwiegend kiesig und weisen keinen oder nur spärlichen<br />
Pflanzenbewuchs auf. Die Sauerstoffsättigung am Ende der Sommerstagnationsphase<br />
liegt bei über 70 %.<br />
Trophiestufe II, mesotroph - mäßiges Nährstoffangebot.<br />
Die geringe Planktonproduktion gewährt noch Sichttiefen von über 2 Metern. Die Ufer sind<br />
mit Schilf und Wasserpflanzen bewachsen und weisen eine hohe Artenvielfalt an Wasserinsekten,<br />
Schnecken, Muscheln und Kleinkrebsen auf. Die Sauerstoffsättigung am Ende der<br />
Sommerstagnationsphase liegt bei 30 bis 70 %.<br />
Trophiestufe III, eutroph - nährstoffreich.<br />
Durch eine starke Planktonproduktion ist die Sichttiefe meist auf weniger als 2 Meter beschränkt.<br />
Die Ufer sind von Schlamm und Wasserpflanzen geprägt. Eine massenhafte Ansammlung<br />
von Schlammrohrwürmern und Zuckmückenlarven im schlammigen Grund zeigen<br />
<strong>Umweltbericht</strong> <strong>Helmstedt</strong> <strong>2005</strong>/<strong>2006</strong> 94