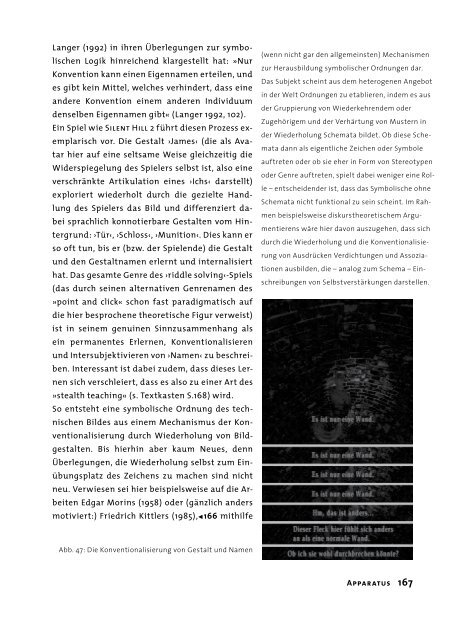Nohr_Natürlichkeit_Onlineversion
Nohr_Natürlichkeit_Onlineversion
Nohr_Natürlichkeit_Onlineversion
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Langer (1992) in ihren Überlegungen zur symbolischen<br />
Logik hinreichend klargestellt hat: »Nur<br />
Konvention kann einen Eigennamen erteilen, und<br />
es gibt kein Mittel, welches verhindert, dass eine<br />
andere Konvention einem anderen Individuum<br />
denselben Eigennamen gibt« (Langer 1992, 102).<br />
Ein Spiel wie Silent Hill 2 führt diesen Prozess exemplarisch<br />
vor. Die Gestalt ›James‹ (die als Avatar<br />
hier auf eine seltsame Weise gleichzeitig die<br />
Widerspiegelung des Spielers selbst ist, also eine<br />
verschränkte Artikulation eines ›Ichs‹ darstellt)<br />
exploriert wiederholt durch die gezielte Handlung<br />
des Spielers das Bild und differenziert dabei<br />
sprachlich konnotierbare Gestalten vom Hintergrund:<br />
›Tür‹, ›Schloss‹, ›Munition‹. Dies kann er<br />
so oft tun, bis er (bzw. der Spielende) die Gestalt<br />
und den Gestaltnamen erlernt und internalisiert<br />
hat. Das gesamte Genre des ›riddle solving‹-Spiels<br />
(das durch seinen alternativen Genrenamen des<br />
»point and click« schon fast paradigmatisch auf<br />
die hier besprochene theoretische Figur verweist)<br />
ist in seinem genuinen Sinnzusammenhang als<br />
ein permanentes Erlernen, Konventionalisieren<br />
und Intersubjektivieren von ›Namen‹ zu beschreiben.<br />
Interessant ist dabei zudem, dass dieses Lernen<br />
sich verschleiert, dass es also zu einer Art des<br />
»stealth teaching« (s. Textkasten S.168) wird.<br />
So entsteht eine symbolische Ordnung des technischen<br />
Bildes aus einem Mechanismus der Konventionalisierung<br />
durch Wiederholung von Bildgestalten.<br />
Bis hierhin aber kaum Neues, denn<br />
Überlegungen, die Wiederholung selbst zum Einübungsplatz<br />
des Zeichens zu machen sind nicht<br />
neu. Verwiesen sei hier beispielsweise auf die Arbeiten<br />
Edgar Morins (1958) oder (gänzlich anders<br />
motiviert:) Friedrich Kittlers (1985),¯166 mithilfe<br />
(wenn nicht gar den allgemeinsten) Mechanismen<br />
zur Herausbildung symbolischer Ordnungen dar.<br />
Das Subjekt scheint aus dem heterogenen Angebot<br />
in der Welt Ordnungen zu etablieren, indem es aus<br />
der Gruppierung von Wiederkehrendem oder<br />
Zugehörigem und der Verhärtung von Mustern in<br />
der Wiederholung Schemata bildet. Ob diese Schemata<br />
dann als eigentliche Zeichen oder Symbole<br />
auftreten oder ob sie eher in Form von Stereotypen<br />
oder Genre auftreten, spielt dabei weniger eine Rolle<br />
– entscheidender ist, dass das Symbolische ohne<br />
Schemata nicht funktional zu sein scheint. Im Rahmen<br />
beispielsweise diskurstheoretischem Argumentierens<br />
wäre hier davon auszugehen, dass sich<br />
durch die Wiederholung und die Konventionalisierung<br />
von Ausdrücken Verdichtungen und Assoziationen<br />
ausbilden, die – analog zum Schema – Einschreibungen<br />
von Selbstverstärkungen darstellen.<br />
Abb. 47: Die Konventionalisierung von Gestalt und Namen<br />
Apparatus 167