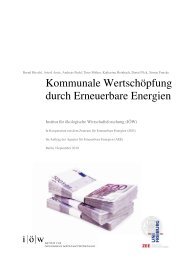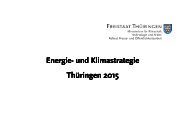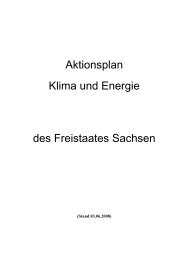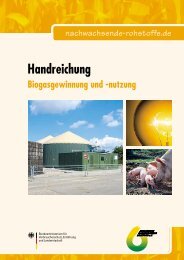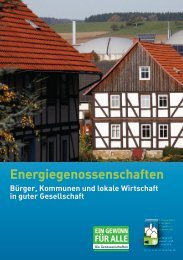Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60 | B. HIRSCHL, A. ARETZ, A. PRAHL, T. BÖTHER, K. HEINBACH, D. PICK, S. FUNCKE<br />
3.3 Photovoltaik-Kleinanlagen<br />
Gerade im Bereich der Photovoltaik ist die Debatte über die Kosten in den Jahren 2009 und 2010<br />
sehr lebhaft geführt worden. Die Photovoltaik steht unter den <strong>Erneuerbare</strong>n als die Technologie mit<br />
den vergleichsweise höchsten spezifischen Stromerzeugungskosten stark unter Beobachtung und<br />
unter Rechtfertigungszwang. Ein wichtiger Aspekt ist daher die Frage, wer von den Kosten, die für<br />
die Photovoltaik aufgewendet werden müssen, eigentlich profitiert, d.h. wo und in welcher Höhe sie<br />
„heimische“ <strong>Wertschöpfung</strong> generiert. Trotz der teilweise hitzigen Diskussionen und einiger Markt-<br />
und Kostenanalysen ist die Datenlage über die <strong>Wertschöpfung</strong>skette der Photovoltaik nicht besser<br />
als bei anderen Ketten. Über die kontroversen Aspekte der öffentlichen Debatte, z.B. über den<br />
Punkt, welche Akteure entlang der <strong>Wertschöpfung</strong>skette eigentlich wie viel Gewinne abschöpfen<br />
(und bei wem folglich wie viel gekürzt werden könne) liegen wenig belastbare Daten vor. Die nachfolgenden<br />
Analysen für die Klein- und die Großanlagen bauen daher auf den Erkenntnissen der aktuellsten<br />
Studien auf und ergänzen sie um plausible Annahmen zu den fehlenden Daten entlang<br />
der <strong>Wertschöpfung</strong>sketten.<br />
3.3.1 Kostenstruktur<br />
3.3.1.1 Kosten für Investition, Planung, Installation und Handel<br />
Zur Ermittlung der spezifischen Investitionskosten wurden aktuelle Studien und Daten u.a. von<br />
Progos (2009) und von der Zeitschrift Photon (2010) ausgewertet. Die in Prognos vorgefundene<br />
Unterteilung hinsichtlich der Modultechnologie (mono-, multikristallin, amorph, CdTe) wurde mit<br />
den in der Photon (2010) veröffentlichten jeweiligen Marktanteilen gewichtet (Tab. 3.13). Für die<br />
Kategorie „Andere“ wird ein Mittelwert der gegebenen Investitionskosten veranschlagt.<br />
Tab. 3.13: Investitionskosten von PV-Kleinanlagen (inkl. Installationskosten) in Deutschland<br />
und Marktanteile der Zellentechnologien im Jahr 2009<br />
Quelle: Eigene Zusammenstellung, Daten nach Prognos (2009), Photon (2010)<br />
Module Hausdach (Haushalt) Marktanteile<br />
monokristallines Silizium 3.250 34 %<br />
multikristallines Silizium 3.360 47 %<br />
amorphes Silizium 2.940 6 %<br />
CdTe 3.220 9 %<br />
Andere 3.193 4 %<br />
Daraus ergibt sich ein <strong>durch</strong>schnittlicher Wert von 3278 €/kW an spezifischen Investitionskosten.<br />
Nach Informationen von Prognos handelt es sich hierbei um Preise inklusive 19 % Umsatzsteuer.<br />
Für die Ermittlung der <strong>Wertschöpfung</strong> müssen an dieser Stelle jedoch die Nettowerte betrachtet<br />
werden. Nach Abzug der einberechneten Umsatzsteuer betragen die spezifischen Investitionskosten<br />
2754 €/kW.<br />
Diese werden im Folgenden auf die Bereiche Module, Wechselrichter, Installationsmaterial, Montage<br />
und Netzanschluss aufgeteilt. Diese Aufgliederung erfolgt auf Basis einer Studie des Instituts<br />
für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS 2009) und Prognos (2009). Den stark unterschiedlichen<br />
Angaben der beiden Studien hinsichtlich des Modulanteils an den Investitionskosten - 75 %