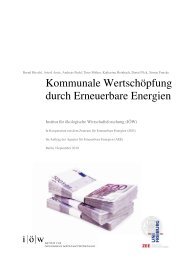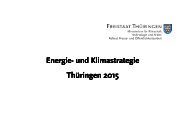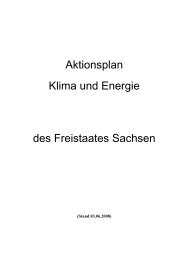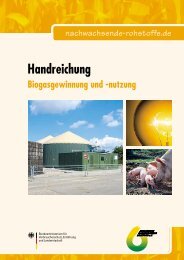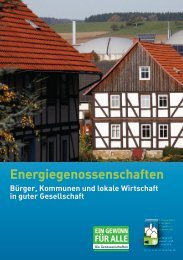Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
70 | B. HIRSCHL, A. ARETZ, A. PRAHL, T. BÖTHER, K. HEINBACH, D. PICK, S. FUNCKE<br />
3.4 Photovoltaik-Großanlagen (Dach und Freiland)<br />
Bei den PV-Großanlagen standen in den Debatten vor der EEG-Novelle 2010 insbesondere die<br />
Freiflächenanlagen stark in der Kritik, da sie in häufigen Fällen landwirtschaftliche Flächen in Anspruch<br />
nehmen, woraus sich ein Potenzial für Nutzungskonkurrenzen dieser Flächen ergibt. Vor<br />
diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber die Errichtung von PV-Großanlagen in der Fläche stark<br />
eingeschränkt auf besondere Standorte wie z.B. Konversionsflächen oder entlang von Autobahnen.<br />
Mit Blick auf die Analyse von <strong>Wertschöpfung</strong>seffekten unterscheiden sich insbesondere die<br />
großen Anlagen von den Kleinanlagen, da hier zum einen teilweise andere Kostenstrukturen bei<br />
der Anlage, der Planung und Installation sowie der technischen Betriebsführung anfallen, zudem<br />
liegen aber auch andere Betreibergesellschaften vor, so dass die diesbezügliche Modellierung anders<br />
als bei den überwiegend privaten Kleinanlagen ausfallen muss. Demgegenüber fällt der Unterschied<br />
zwischen Dach- und Freiflächenanlagen mit Blick auf die Analyse von <strong>Wertschöpfung</strong>seffekten<br />
nicht deutlich ins Gewicht, so dass sie hier gemeinsam behandelt werden. Die Datenlage<br />
und –qualität ist bei den Großanlagen leicht besser als bei den PV-Kleinanlagen. Dies ist u.a. darauf<br />
zurückzuführen, dass <strong>durch</strong> eine Auswertung von Beteiligungsprospekten von PV-Großanlagen<br />
eine empirisch angereicherte Datenbasis für die Ermittlung der <strong>Wertschöpfung</strong>sschritte und diesbezüglicher<br />
Kosten geschaffen werden konnte.<br />
3.4.1 Kostenstrukturen<br />
3.4.1.1 Kosten für Investition, Planung, Installation und Handel<br />
Zur Ermittlung der spezifischen Investitionskosten wurden aktuelle Studien und Daten u.a. von<br />
Progos (2009) und von der Zeitschrift Photon (2010) ausgewertet. Die in Prognos vorgefundene<br />
Unterteilung hinsichtlich der Modultechnologie (mono-, multikristallin, amorph, CdTe) wurde mit<br />
den in der Photon (2010) veröffentlichten jeweiligen Marktanteilen gewichtet (Tab. 3.20). Für die<br />
Kategorie „Andere“ wird ein Mittelwert der gegebenen Investitionskosten veranschlagt.<br />
Tab. 3.20: Investitionskosten von PV-Großanlagen (inkl. Installationskosten) in Deutschland<br />
und Marktanteile der Zellentechnologien im Jahr 2009<br />
Quelle: Eigene Zusammenstellung, Daten nach Prognos (2009), Photon (2010)<br />
Module<br />
monokristallines<br />
Silizium<br />
multikristallines<br />
Silizium<br />
Hausdach<br />
(gewerblich)<br />
Feldinstallation Marktanteile<br />
2.980 2.840 34 %<br />
3.090 2.950 47 %<br />
amorphes Silizium 2.670 2.530 6 %<br />
CdTe 2.950 2.820 9 %<br />
Andere 2.923 2.785 4 %<br />
Es ergeben sich somit spezifische Investitionskosten von 2.869 €/kW für Freiflächenanlagen und<br />
3.008 €/kW für dachmontierte Großanlagen. Wie auch bei den Kleinanlagen handelt es sich hierbei<br />
um Werte inklusive 19 % Umsatzsteuer. Die Netto-Investitionskosten betragen somit 2.411 €/kW