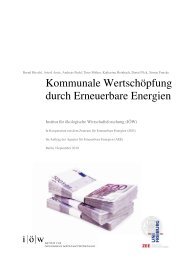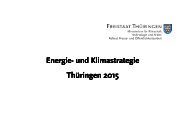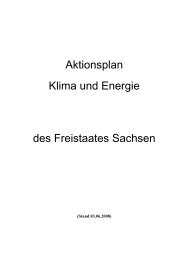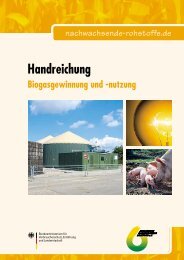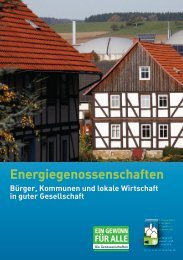Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Kommunale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KOMMUNALE WERTSCHÖPFUNG DURCH ERNEUERBARE ENERGIEN | 63<br />
Weiterhin müssen Abschreibungen auf die gesamten Investitionskosten berücksichtigt werden,<br />
welche sich bei linearer Abschreibung über 20 Jahre Laufzeit auf etwa 138 €/kW belaufen.<br />
Die nachfolgende Tabelle fasst die für die Betriebsphase pro Jahr anfallenden Kostenpositionen<br />
sowie die für die nachfolgenden Berechnungen relevanten Umsätze zusammen.<br />
Tab. 3.15: Betriebskosten von PV-Kleinanlagen und generierte Umsätze relevanter <strong>Wertschöpfung</strong>sschritte<br />
Quelle: Eigene Berechnungen<br />
Kosten<br />
[€/kW]<br />
Umsatz<br />
[€/kW]<br />
Wartung & Instandhaltung 36 64<br />
Versicherung 6 6<br />
Fremdkapitalzinsen 32 -<br />
Abschreibungen 138 -<br />
3.3.2 Gewinne<br />
Für die Ermittlung der Gewinne der PV-Industrie bzw. der einzelnen industriellen <strong>Wertschöpfung</strong>sschritte<br />
werden einerseits statistische Werte der zugehörigen Wirtschaftszweige herangezogen,<br />
andererseits werden auf der Basis von eingeschätzten Branchenspezifika entsprechende Abweichungen<br />
vorgenommen. Die PV-Industrie kann im Wesentlichen den Wirtschaftszweigen Elektrotechnik<br />
und Maschinenbau zugeordnet werden. Die Durchschnittswerte der jeweiligen Branchenrentabilitäten<br />
für diese Zweige liegen bei (jeweils Vor- und Nach-Steuer-Wert) 5,3 % bzw. 4 % für<br />
den Maschinenbau und bei 3,5 % bzw. 2,5 % für die Elektrotechnik (Deutsche Bundesbank<br />
2009b). Eine eigene Auswertung von Unternehmensdaten der PV-Industrie hat gezeigt, dass die<br />
Renditen teilweise deutlich höher gelegen haben, allerdings lässt sich aus der geringen Fallzahl öffentlich<br />
verfügbarer Renditedaten kein Rückschluss auf die Performance der gesamten PV-<br />
Industrie je <strong>Wertschöpfung</strong>sschritt ableiten. Unter den analysierten Unternehmen waren auch einige,<br />
die aufgrund größerer Investments negative Renditen aufwiesen, wenn gleich sie am Markt gut<br />
aufgestellt waren. Aus der Einschätzung, dass die Renditen der Wafer- und Zellenhersteller, die<br />
dem Wirtschaftszweig Elektrotechnik zuzuordnen sind (vgl. Statistisches Bundesamt 2008), wahrscheinlich<br />
etwas höher liegen dürften als der statistisch ermittelte Durchschnitt der gesamten Elektrotechnik-Unternehmen,<br />
wurden hier ein Mittelwert aus Maschinenbau und Elektrotechnik angesetzt.<br />
Neben den hier angesprochenen Wirtschaftszweigen spielen hier im Wesentlichen noch die<br />
Zweige unternehmensnahe Dienstleistungen sowie Großhandel eine Rolle.<br />
Für die Finanzierung, die im Wesentlichen <strong>durch</strong> Fremdkapital erfolgt, wird ein Zinssatz von 4 %<br />
und eine Laufzeit von 20 Jahren angenommen (vgl. Staiß et al. 2007). Die <strong>durch</strong>schnittliche Restschuld<br />
beträgt gemäß unserer Kosten- und Finanzierungsannahmen in etwa 812 €/kW.<br />
Für die Ermittlung des Betreibergewinns wird davon ausgegangen, dass es sich im Regelfall bei<br />
den Kleinanlagen um einen Einzelunternehmer handelt, dessen jährliche Erträge der betrachteten<br />
Anlage unter dem Freibetrag liegen. Daher wird in diesem Fall keine Gewerbesteuer fällig. Der<br />
Vor-Steuer-Gewinn berechnet sich dann aus den Einkünften der EEG-Vergütung abzüglich der Betriebskosten.<br />
Die jährliche Verzinsung des Eigenkapitals nach Zahlung der Gewerbesteuer beträgt<br />
14 %.