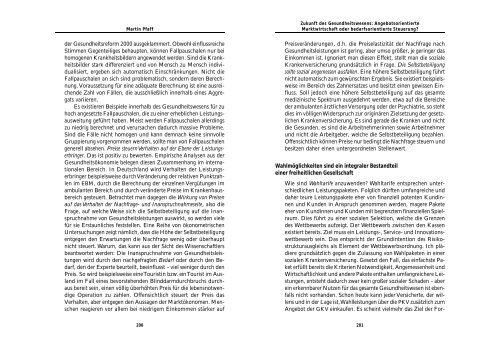"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Martin Pfaff<br />
der Gesundheitsreform 2000 ausgeklammert. Obwohl einflussreiche<br />
Stimmen Gegenteiliges behaupten, können Fallpauschalen nur bei<br />
homogenen Krankheitsbildern angewendet werden. Sind die Krankheitsbilder<br />
stark differenziert und von Mensch zu Mensch individualisiert,<br />
ergeben sich automatisch Einschränkungen. Nicht die<br />
Fallpauschalen an sich sind problematisch, sondern deren Berechnung.<br />
Voraussetzung für eine adäquate Berechnung ist eine ausreichende<br />
Zahl von Fällen, die ausschließlich innerhalb eines Aggregats<br />
variieren.<br />
Es existieren Beispiele innerhalb des Gesundheitswesens für zu<br />
hoch angesetzte Fallpauschalen, die zu einer erheblichen Leistungsausweitung<br />
geführt haben. Meist werden Fallpauschalen allerdings<br />
zu niedrig berechnet und verursachen dadurch massive Probleme.<br />
Sind die Fälle nicht homogen und kann demnach keine sinnvolle<br />
Gruppierung vorgenommen werden, sollte man von Fallpauschalen<br />
generell absehen. Preise steuern Verhalten auf der Ebene der Leistungserbringer.<br />
Das ist positiv zu bewerten. Empirische Analysen aus der<br />
Gesundheitsökonomie belegen diesen Zusammenhang im internationalen<br />
Bereich. In Deutschland wird Verhalten der Leistungserbringer<br />
beispielsweise durch Veränderung der relativen Punktzahlen<br />
im EBM, durch die Berechnung der einzelnen Vergütungen im<br />
ambulanten Bereich und durch veränderte Preise im <strong>Kranke</strong>nhausbereich<br />
gesteuert. Betrachtet man dagegen die Wirkung von Preisen<br />
auf das Verhalten der Nachfrage- und Inanspruchnahmeseite, also die<br />
Frage, auf welche Weise sich die Selbstbeteiligung auf die Inanspruchnahme<br />
von Gesundheitsleistungen auswirkt, so werden viele<br />
für sie Erstaunliches feststellen. Eine Reihe von ökonometrischen<br />
Untersuchungen zeigt nämlich, dass die Höhe der Selbstbeteiligung<br />
entgegen den Erwartungen die Nachfrage wenig oder überhaupt<br />
nicht steuert. Warum, das kann aus der Sicht des Wissenschaftlers<br />
beantwortet werden: Die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen<br />
wird durch den nachgefragten Bedarf oder durch den Bedarf,<br />
den der Experte beurteilt, beeinflusst – viel weniger durch den<br />
Preis. So wird beispielsweise eine Touristin bzw. ein Tourist im Ausland<br />
im Fall eines bevorstehenden Blinddarmdurchbruchs durchaus<br />
bereit sein, einen völlig überhöhten Preis für die lebensnotwendige<br />
Operation zu zahlen. Offensichtlich steuert der Preis das<br />
Verhalten, aber entgegen den Aussagen der Marktökonomen. Menschen<br />
reagieren vor allem bei niedrigem Einkommen stärker auf<br />
Zukunft des Gesundheitswesens: Angebotsorientierte<br />
Marktwirtschaft oder bedarfsorientierte Steuerung?<br />
200 201<br />
Preisveränderungen, d.h. die Preiselastizität der Nachfrage nach<br />
Gesundheitsleistungen ist gering, aber umso größer, je geringer das<br />
Einkommen ist. Ignoriert man diesen Effekt, stellt man die soziale<br />
<strong>Kranke</strong>nversicherung grundsätzlich in Frage. Die Selbstbeteiligung<br />
sollte sozial angemessen ausfallen. Eine höhere Selbstbeteiligung führt<br />
nicht automatisch zum gewünschten Ergebnis. Sie existiert beispielsweise<br />
im Bereich des Zahnersatzes und besitzt einen gewissen Einfluss.<br />
Soll jedoch eine höhere Selbstbeteiligung auf das gesamte<br />
medizinische Spektrum ausgedehnt werden, etwa auf die Bereiche<br />
der ambulanten ärztlichen Versorgung oder der <strong>Psychiatrie</strong>, so steht<br />
dies im völligen Widerspruch zur originären Zielsetzung der gesetzlichen<br />
<strong>Kranke</strong>nversicherung. Es sind gerade die <strong>Kranke</strong>n und nicht<br />
die Gesunden, es sind die Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer<br />
und nicht die Arbeitgeber, welche die Selbstbeteiligung bezahlen.<br />
Offensichtlich können Preise nur bedingt die Nachfrage steuern und<br />
besitzen daher einen untergeordneten Stellenwert.<br />
Wahlmöglichkeiten sind ein integraler Bestandteil<br />
einer freiheitlichen Gesellschaft<br />
Wie sind Wahltarife anzuwenden? Wahltarife entsprechen unterschiedlichen<br />
Leistungspaketen. Folglich dürften umfangreiche und<br />
daher teure Leistungspakete eher von finanziell potenten Kundinnen<br />
und Kunden in Anspruch genommen werden, magere Pakete<br />
eher von Kundinnen und Kunden mit begrenztem finanziellen Spielraum.<br />
Dies führt zu einer sozialen Selektion, welche die Grenzen<br />
des Wettbewerbs aufzeigt. Der Wettbewerb zwischen den Kassen<br />
existiert bereits. Ziel muss ein Leistungs-, Service- und Innovationswettbewerb<br />
sein. Das entspricht der Grundintention des Risikostrukturausgleichs<br />
als Element der Wettbewerbsordnung. Ich plädiere<br />
grundsätzlich gegen die Zulassung von Wahlpaketen in einer<br />
sozialen <strong>Kranke</strong>nversicherung. Gesetzt den Fall, das einfachste Paket<br />
erfüllt bereits die Kriterien Notwendigkeit, Angemessenheit und<br />
Wirtschaftlichkeit und andere Pakete enthalten umfangreichere Leistungen,<br />
entsteht dadurch zwar kein großer sozialer Schaden – aber<br />
ein erkennbarer Nutzen für das gesamte Gesundheitswesen ist ebenfalls<br />
nicht vorhanden. Schon heute kann jeder Versicherte, der willens<br />
und in der Lage ist, Wahlleistungen über die PKV zusätzlich zum<br />
Angebot der GKV einkaufen. Es scheint vielmehr das Ziel der For-