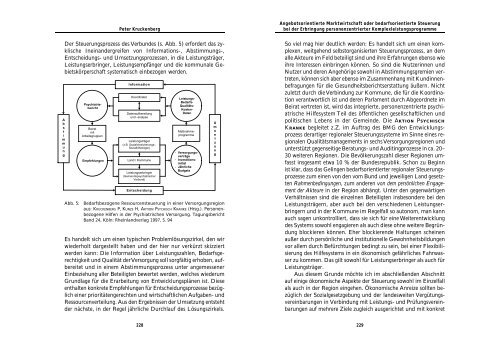"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Steuerungsprozess des Verbundes (s. Abb. 5) erfordert das zyklische<br />
Ineinandergreifen von Informations-, Abstimmungs-,<br />
Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen, in die Leistungsträger,<br />
Leistungserbringer, Leistungsempfänger und die kommunale Gebietskörperschaft<br />
systematisch einbezogen werden.<br />
A<br />
b<br />
s<br />
t<br />
i<br />
m<br />
m<br />
u<br />
n<br />
g<br />
<strong>Psychiatrie</strong>-<br />
bericht<br />
Beirat<br />
mit<br />
Arbeitsgruppen<br />
Empfehlungen<br />
Peter Kruckenberg<br />
Information<br />
Koordinator<br />
Datenaufbereitung<br />
und -analyse<br />
Leistungsträger<br />
(z.B. Sozialversicherungs-,<br />
Sozialhilfeträger)<br />
Land / Kommune<br />
Leistungserbringer<br />
(Gemeindepsychiatrischer<br />
Verbund)<br />
Entscheidung<br />
Leistungs-<br />
Bedarfs-<br />
Qualitäts-<br />
Kosten-<br />
Daten<br />
Maßnahme-<br />
programme<br />
- Versorgungs-<br />
verträge<br />
- Investitions-<br />
mittel<br />
- Jährliche<br />
Budgets<br />
Abb. 5: Bedarfsbezogene Ressourcensteuerung in einer Versorgungsregion<br />
aus: KRUCKENBERG P, KUNZE H, AKTION PSYCHISCH KRANKE (Hrsg.). Personenbezogene<br />
Hilfen in der Psychiatrischen Versorgung. Tagungsbericht<br />
Band 24, Köln: Rheinlandverlag 1997, S. 94<br />
Es handelt sich um einen typischen Problemlösungszirkel, den wir<br />
wiederholt dargestellt haben und der hier nur verkürzt skizziert<br />
werden kann: Die Information über Leistungszahlen, Bedarfsgerechtigkeit<br />
und Qualität der Versorgung soll sorgfältig erhoben, aufbereitet<br />
und in einem Abstimmungsprozess unter angemessener<br />
Einbeziehung aller Beteiligten bewertet werden, welches wiederum<br />
Grundlage für die Erarbeitung von Entwicklungsplänen ist. Diese<br />
enthalten konkrete Empfehlungen für Entscheidungsprozesse bezüglich<br />
einer prioritätengerechten und wirtschaftlichen Aufgaben- und<br />
Ressourcenverteilung. Aus den Ergebnissen der Umsetzung entsteht<br />
der nächste, in der Regel jährliche Durchlauf des Lösungszirkels.<br />
U<br />
m<br />
s<br />
e<br />
t<br />
z<br />
u<br />
n<br />
g<br />
Angebotsorientierte Marktwirtschaft oder bedarfsorientierte Steuerung<br />
bei der Erbringung personenzentrierter Komplexleistungsprogramme<br />
228 229<br />
So viel mag hier deutlich werden: Es handelt sich um einen komplexen,<br />
weitgehend selbstorganisierten Steuerungsprozess, an dem<br />
alle Akteure im Feld beteiligt sind und ihre Erfahrungen ebenso wie<br />
ihre Interessen einbringen können. So sind die Nutzerinnen und<br />
Nutzer und deren Angehörige sowohl in Abstimmungsgremien vertreten,<br />
können sich aber ebenso im Zusammenhang mit Kundinnenbefragungen<br />
für die Gesundheitsberichtserstattung äußern. Nicht<br />
zuletzt durch die Verbindung zur Kommune, die für die Koordination<br />
verantwortlich ist und deren Parlament durch Abgeordnete im<br />
Beirat vertreten ist, wird das integrierte, personenzentrierte psychiatrische<br />
Hilfesystem <strong>Teil</strong> des öffentlichen gesellschaftlichen und<br />
politischen Lebens in der Gemeinde. Die AKTION PSYCHISCH<br />
KRANKE begleitet z.Z. im Auftrag des BMG den Entwicklungsprozess<br />
derartiger regionaler Steuerungssysteme im Sinne eines regionalen<br />
Qualitätsmanagements in sechs Versorgungsregionen und<br />
unterstützt gegenseitige Beratungs- und Auditingprozesse in ca. 20–<br />
30 weiteren Regionen. Die Bevölkerungszahl dieser Regionen umfasst<br />
insgesamt etwa 10 % der Bundesrepublik. Schon zu Beginn<br />
ist klar, dass das Gelingen bedarfsorientierter regionaler Steuerungsprozesse<br />
zum einen von den vom Bund und jeweiligen Land gesetzten<br />
Rahmenbedingungen, zum anderen von dem persönlichen Engagement<br />
der Akteure in der Region abhängt. Unter den gegenwärtigen<br />
Verhältnissen sind die einzelnen Beteiligten insbesondere bei den<br />
Leistungsträgern, aber auch bei den verschiedenen Leistungserbringern<br />
und in der Kommune im Regelfall so autonom, man kann<br />
auch sagen unkontrolliert, dass sie sich für eine Weiterentwicklung<br />
des Systems sowohl engagieren als auch diese ohne weitere Begründung<br />
blockieren können. Eher blockierende Haltungen scheinen<br />
außer durch persönliche und institutionelle Gewohnheitsbildungen<br />
vor allem durch Befürchtungen bedingt zu sein, bei einer Flexibilisierung<br />
des Hilfesystems in ein ökonomisch gefährliches Fahrwasser<br />
zu kommen. Das gilt sowohl für Leistungserbringer als auch für<br />
Leistungsträger.<br />
Aus diesem Grunde möchte ich im abschließenden Abschnitt<br />
auf einige ökonomische Aspekte der Steuerung sowohl im Einzelfall<br />
als auch in der Region eingehen. Ökonomische Anreize sollten bezüglich<br />
der Sozialgesetzgebung und der landesweiten Vergütungsvereinbarungen<br />
in Verbindung mit Leistungs- und Prüfungsvereinbarungen<br />
auf mehrere Ziele zugleich ausgerichtet und mit konkret