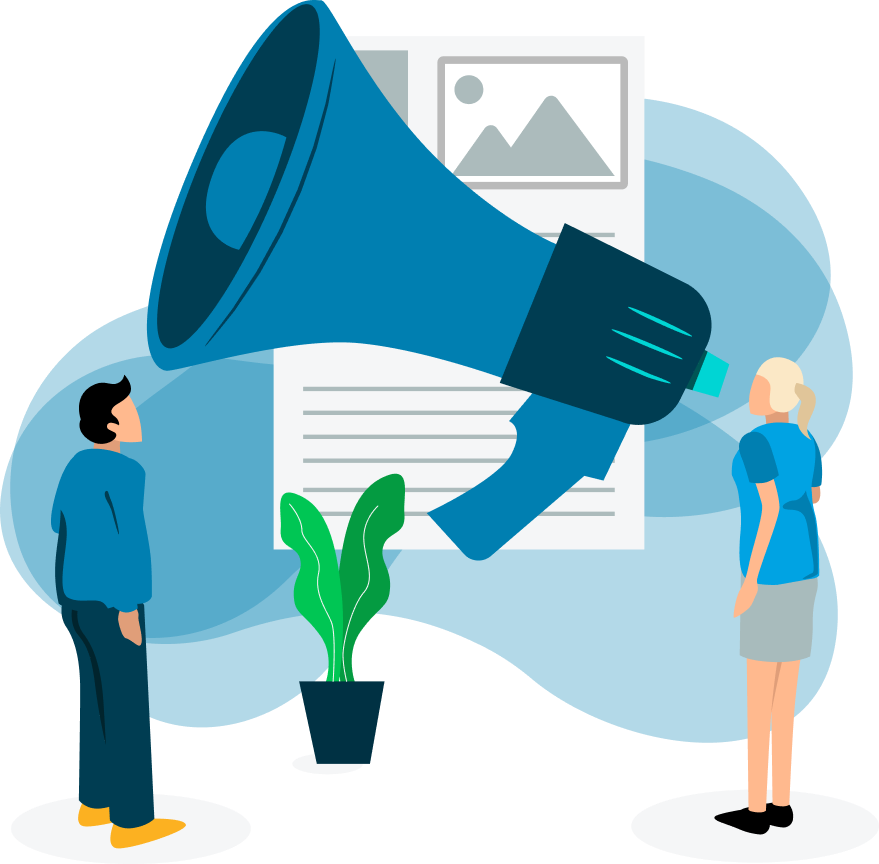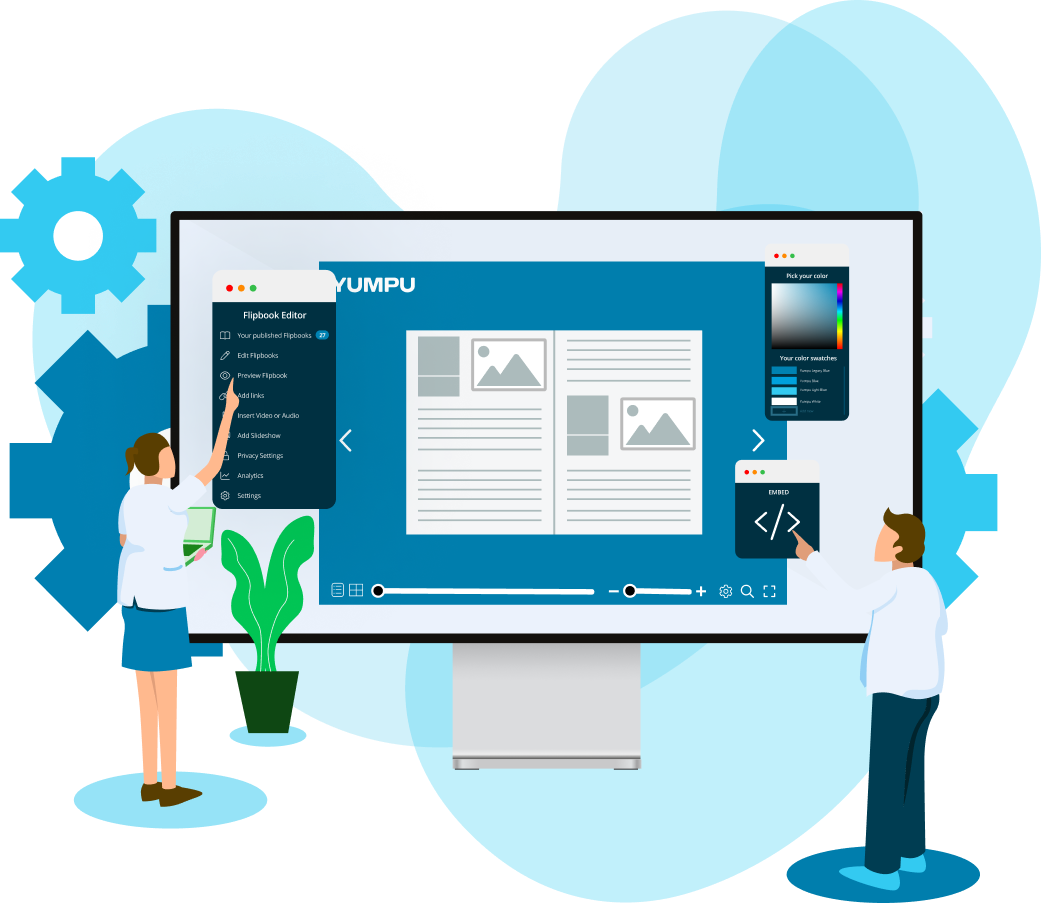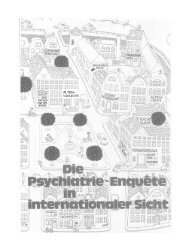"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Stefan Priebe und Maria Vidal Die Rolle der Hausärzte in der psychiatrischen Versorgung in England<br />
und direkte Ratschläge des Psychiaters zur Verschreibung der Psychopharmaka,<br />
denen zumeist auch gefolgt wird. Bei Patienten mit<br />
schweren psychischen Erkrankungen werden einer gesetzlichen Vorschrift<br />
folgend, regelmäßig, d.h. zumindest alle sechs Monate, Fallkonferenzen<br />
abgehalten, zu denen neben den Patienten selbst, ihre<br />
Angehörigen, ihr Betreuer und ihr Psychiater auch stets der GP eingeladen<br />
wird. Bei diesen Fallkonferenzen wird ein schriftlicher Behandlungsplan<br />
erstellt, dem idealerweise alle Beteiligten zustimmen.<br />
Sollen bei Patienten Zwangseinweisungen oder –behandlungen vorgenommen<br />
werden, muss der GP, sofern er irgendwie erreichbar ist,<br />
als Gutachter gefragt werden. Seine Zustimmung ist zur Einrichtung<br />
der Zwangsmaßnahme erforderlich und kann nur in Ausnahmefällen<br />
umgangen werden. Patienten, die an sekundäre Einrichtungen<br />
weiter verwiesen werden, verschwinden also nicht aus dem<br />
Blickfeld des GPs, sondern bleiben – im gewissen Rahmen – in seiner<br />
Zuständigkeit, wodurch sich unmittelbar die Notwendigkeit einer<br />
guten Zusammenarbeit zwischen GPs und sekundären Einrichtungen<br />
ergibt. Hierfür haben sich in der Praxis verschiedene Modelle<br />
entwickelt, die sich in Abhängigkeit von regionalen Gegebenheiten<br />
und vor allem der beteiligten Personen sehr unterscheiden können.<br />
Wenn Patienten einem Psychiater vorgestellt werden, heißt dies nicht<br />
unbedingt, dass dieser die weitere Behandlung übernehmen soll.<br />
Häufig erwartet der GP lediglich einen Rat zur weiteren Behandlung,<br />
die dann von ihm selbst vorgenommen wird. Die meisten<br />
Psychiater sehen solche Patienten in ihren eigenen Einrichtungen,<br />
andere halten entsprechende Sprechstunden in den Praxen der GPs<br />
ab (CREED & MARKS, 1989). Gegebenenfalls arbeiten Psychiater<br />
dort direkt nicht nur mit dem Patienten, sondern auch mit den<br />
Angestellten der Praxis zusammen und leisten entsprechende Fortbildungsarbeit,<br />
was sich als ein effizienter Ansatz erwiesen hat. Essenziell<br />
ist in jedem Fall eine gute Kommunikation, wofür sich regelmäßige<br />
Treffen in den Räumen der Praxis bewährt haben (MIDGLEY<br />
et al., 1996).<br />
Bisher wurde nur das staatliche Gesundheitssystem geschildert,<br />
daneben gibt es auch einen privaten Markt. GPs haben die Möglichkeit,<br />
ihre Patienten zu Privatbehandlungen zu überweisen, sofern<br />
die Patienten hierfür speziell versichert sind oder bereit sind,<br />
das Geld aus eigener Tasche zu bezahlen. In der Londoner Harley<br />
Street gibt es eine ganze Reihe privater Praxen, die häufig nur als<br />
94 95<br />
<strong>Teil</strong>zeitbeschäftigung betrieben diesem Klientel zur Verfügung stehen<br />
und auch auf private Kliniken für stationäre Behandlungen<br />
zurückgreifen können. Dieser private Markt hat aber in der <strong>Psychiatrie</strong><br />
quantitativ eine äußerst geringe Bedeutung und stellt in der<br />
Praxis für die überwiegende Mehrzahl der Patienten keine realistische<br />
Alternative dar.<br />
Versorgung ethnischer Minoritäten<br />
Eine besondere Herausforderung für das englische Gesundheitssystem<br />
ist die adäquate psychiatrische Versorgung von Angehörigen<br />
ethnischer Minoritäten. Dies gilt auch für die GPs, von denen viele<br />
selbst – zumeist aus Ländern des Commonwealth stammend – nach<br />
England eingewandert sind. Verschiedene Studien haben gezeigt,<br />
dass die Erkennungsrate psychischer Störungen durch GPs auch von<br />
der ethnischen Herkunft der Patienten beeinflusst werden kann. So<br />
wurden psychische Störungen bei Frauen indischer Herkunft besonders<br />
häufig übersehen (JACOB et al., 1998). Bei schwarzen Patienten<br />
fand sich ebenfalls eine besonders schlechte Erkennungsrate<br />
psychischer Störungen durch GPs (COMMANDER et al.,1997), und<br />
GPs berichteten, dass sie sich für die Behandlung dieser Patienten<br />
z.T. weniger einsetzten als für Patienten anderer Herkunft (BINDMAN<br />
et al., 1997). Je genauer die Untersuchungen in diesem Bereich sind,<br />
desto differenzierter scheinen auch die psychologischen und sozialen<br />
Faktoren, die für die unterschiedliche Diagnosestellung und<br />
Behandlung bei einzelnen ethnischen Minoritäten verantwortlich<br />
sein können. Es bleibt aber festzuhalten, dass die psychiatrische<br />
Versorgung von Patienten von ethnischen Minoritäten für die Forschung<br />
und für die Praxis eine Aufgabe mit derzeit hoher politischer<br />
Priorität ist. Bisher weiß man nur, dass offensichtliche Ungleichheiten<br />
bestehen und dass simple Erklärungen hierfür nicht ausreichen.<br />
Fortbildung<br />
GPs erleben sich als viel beschäftigte Leute mit wenig Zeit, sodass<br />
Fortbildungsangebote kurz und konzentriert sein müssen, um akzeptiert<br />
und genutzt zu werden. Hierfür sind zahlreiche Trainingsprogramme<br />
entwickelt worden, die GPs in die Lage versetzen sollen,<br />
psychiatrische Patienten besser zu diagnostizieren und zu behandeln.