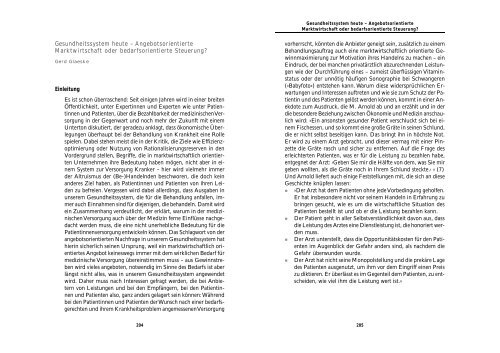"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesundheitssystem heute – Angebotsorientierte<br />
Marktwirtschaft oder bedarfsorientierte Steuerung?<br />
Gerd Glaeske<br />
Einleitung<br />
Es ist schon überraschend: Seit einigen <strong>Jahre</strong>n wird in einer breiten<br />
Öffentlichkeit, unter Expertinnen und Experten wie unter Patientinnen<br />
und Patienten, über die Bezahlbarkeit der medizinischen Versorgung<br />
in der Gegenwart und noch mehr der Zukunft mit einem<br />
Unterton diskutiert, der geradezu anklagt, dass ökonomische Überlegungen<br />
überhaupt bei der Behandlung von Krankheit eine Rolle<br />
spielen. Dabei stehen meist die in der Kritik, die Ziele wie Effizienzoptimierung<br />
oder Nutzung von Rationalisierungsreserven in den<br />
Vordergrund stellen, Begriffe, die in marktwirtschaftlich orientierten<br />
Unternehmen ihre Bedeutung haben mögen, nicht aber in einem<br />
System zur Versorgung <strong>Kranke</strong>r – hier wird vielmehr immer<br />
der Altruismus der (Be-)Handelnden beschworen, die doch kein<br />
anderes Ziel haben, als Patientinnen und Patienten von ihren Leiden<br />
zu befreien. Vergessen wird dabei allerdings, dass Ausgaben in<br />
unserem Gesundheitssystem, die für die Behandlung anfallen, immer<br />
auch Einnahmen sind für diejenigen, die behandeln. Damit wird<br />
ein Zusammenhang verdeutlicht, der erklärt, warum in der medizinischen<br />
Versorgung auch über der Medizin ferne Einflüsse nachgedacht<br />
werden muss, die eine nicht unerhebliche Bedeutung für die<br />
Patientinnenversorgung entwickeln können. Das Schlagwort von der<br />
angebotsorientierten Nachfrage in unserem Gesundheitssystem hat<br />
hierin sicherlich seinen Ursprung, weil ein marktwirtschaftlich orientiertes<br />
Angebot keineswegs immer mit dem wirklichen Bedarf für<br />
medizinische Versorgung übereinstimmen muss – aus Gewinnstreben<br />
wird vieles angeboten, notwendig im Sinne des Bedarfs ist aber<br />
längst nicht alles, was in unserem Gesundheitssystem angewendet<br />
wird. Daher muss nach Interessen gefragt werden, die bei Anbietern<br />
von Leistungen und bei den Empfängern, bei den Patientinnen<br />
und Patienten also, ganz anders gelagert sein können: Während<br />
bei den Patientinnen und Patienten der Wunsch nach einer bedarfsgerechten<br />
und ihrem Krankheitsproblem angemessenen Versorgung<br />
Gesundheitssystem heute – Angebotsorientierte<br />
Marktwirtschaft oder bedarfsorientierte Steuerung?<br />
204 205<br />
vorherrscht, könnten die Anbieter geneigt sein, zusätzlich zu einem<br />
Behandlungsauftrag auch eine marktwirtschaftlich orientierte Gewinnmaximierung<br />
zur Motivation ihres Handelns zu machen – ein<br />
Eindruck, der bei manchen privatärztlich abzurechnenden Leistungen<br />
wie der Durchführung eines – zumeist überflüssigen Vitaminstatus<br />
oder der unnötig häufigen Sonographie bei Schwangeren<br />
(»Babyfoto«) entstehen kann. Warum diese widersprüchlichen Erwartungen<br />
und Interessen auftreten und wie sie zum Schutz der Patientin<br />
und des Patienten gelöst werden können, kommt in einer Anekdote<br />
zum Ausdruck, die M. Arnold ab und an erzählt und in der<br />
die besondere Beziehung zwischen Ökonomie und Medizin anschaulich<br />
wird: »Ein ansonsten gesunder Patient verschluckt sich bei einem<br />
Fischessen, und so kommt eine große Gräte in seinen Schlund,<br />
die er nicht selbst beseitigen kann. Das bringt ihn in höchste Not.<br />
Er wird zu einem Arzt gebracht, und dieser vermag mit einer Pinzette<br />
die Gräte rasch und sicher zu entfernen. Auf die Frage des<br />
erleichterten Patienten, was er für die Leistung zu bezahlen habe,<br />
entgegnet der Arzt: ›Geben Sie mir die Hälfte von dem, was Sie mir<br />
geben wollten, als die Gräte noch in Ihrem Schlund steckte.‹ « (7)<br />
Und Arnold liefert auch einige Feststellungen mit, die sich an diese<br />
Geschichte knüpfen lassen:<br />
� »Der Arzt hat dem Patienten ohne jede Vorbedingung geholfen.<br />
Er hat insbesondere nicht vor seinem Handeln in Erfahrung zu<br />
bringen gesucht, wie es um die wirtschaftliche Situation des<br />
Patienten bestellt ist und ob er die Leistung bezahlen kann.<br />
� Der Patient geht in aller Selbstverständlichkeit davon aus, dass<br />
die Leistung des Arztes eine Dienstleistung ist, die honoriert werden<br />
muss.<br />
� Der Arzt unterstellt, dass die Opportunitätskosten für den Patienten<br />
im Augenblick der Gefahr anders sind, als nachdem die<br />
Gefahr überwunden wurde.<br />
� Der Arzt hat nicht seine Monopolstellung und die prekäre Lage<br />
des Patienten ausgenutzt, um ihm vor dem Eingriff einen Preis<br />
zu diktieren. Er überlässt es im Gegenteil dem Patienten, zu entscheiden,<br />
wie viel ihm die Leistung wert ist.«