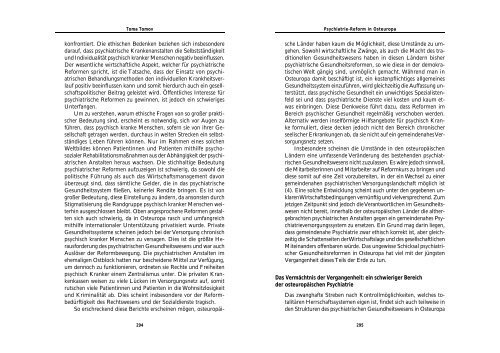"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
"25 Jahre Psychiatrie-Enquete" Teil II - Aktion Psychisch Kranke e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Toma Tomov <strong>Psychiatrie</strong>-Reform in Osteuropa<br />
konfrontiert. Die ethischen Bedenken beziehen sich insbesondere<br />
darauf, dass psychiatrische <strong>Kranke</strong>nanstalten die Selbstständigkeit<br />
und Individualität psychisch kranker Menschen negativ beeinflussen.<br />
Der wesentliche wirtschaftliche Aspekt, welcher für psychiatrische<br />
Reformen spricht, ist die Tatsache, dass der Einsatz von psychiatrischen<br />
Behandlungsmethoden den individuellen Krankheitsverlauf<br />
positiv beeinflussen kann und somit hierdurch auch ein gesellschaftspolitischer<br />
Beitrag geleistet wird. Öffentliches Interesse für<br />
psychiatrische Reformen zu gewinnen, ist jedoch ein schwieriges<br />
Unterfangen.<br />
Um zu verstehen, warum ethische Fragen von so großer praktischer<br />
Bedeutung sind, erscheint es notwendig, sich vor Augen zu<br />
führen, dass psychisch kranke Menschen, sofern sie von ihrer Gesellschaft<br />
getragen werden, durchaus in weiten Strecken ein selbstständiges<br />
Leben führen können. Nur im Rahmen eines solchen<br />
Weltbildes können Patientinnen und Patienten mithilfe psychosozialer<br />
Rehabilitationsmaßnahmen aus der Abhängigkeit der psychiatrischen<br />
Anstalten heraus wachsen. Die stichhaltige Bedeutung<br />
psychiatrischer Reformen aufzuzeigen ist schwierig, da sowohl die<br />
politische Führung als auch das Wirtschaftsmanagement davon<br />
überzeugt sind, dass sämtliche Gelder, die in das psychiatrische<br />
Gesundheitssystem fließen, keinerlei Rendite bringen. Es ist von<br />
großer Bedeutung, diese Einstellung zu ändern, da ansonsten durch<br />
Stigmatisierung die Randgruppe psychisch kranker Menschen weiterhin<br />
ausgeschlossen bleibt. Oben angesprochene Reformen gestalten<br />
sich auch schwierig, da in Osteuropa rasch und umfangreich<br />
mithilfe internationaler Unterstützung privatisiert wurde. Private<br />
Gesundheitssysteme scheinen jedoch bei der Versorgung chronisch<br />
psychisch kranker Menschen zu versagen. Dies ist die größte Herausforderung<br />
des psychiatrischen Gesundheitswesens und war auch<br />
Auslöser der Reformbewegung. Die psychiatrischen Anstalten im<br />
ehemaligen Ostblock hatten nur bescheidene Mittel zur Verfügung,<br />
um dennoch zu funktionieren, ordneten sie Rechte und Freiheiten<br />
psychisch <strong>Kranke</strong>r einem Zentralismus unter. Die privaten <strong>Kranke</strong>nkassen<br />
weisen zu viele Lücken im Versorgungsnetz auf, somit<br />
rutschen viele Patientinnen und Patienten in die Wohnsitzlosigkeit<br />
und Kriminalität ab. Dies scheint insbesondere vor der Reformbedürftigkeit<br />
des Rechtswesens und der Sozialdienste tragisch.<br />
So erschreckend diese Berichte erscheinen mögen, osteuropäi-<br />
294 295<br />
sche Länder haben kaum die Möglichkeit, diese Umstände zu umgehen.<br />
Sowohl wirtschaftliche Zwänge, als auch die Macht des traditionellen<br />
Gesundheitswesens haben in diesen Ländern bisher<br />
psychiatrische Gesundheitsreformen, so wie diese in der demokratischen<br />
Welt gängig sind, unmöglich gemacht. Während man in<br />
Osteuropa damit beschäftigt ist, ein kostenpflichtiges allgemeines<br />
Gesundheitssystem einzuführen, wird gleichzeitig die Auffassung unterstützt,<br />
dass psychische Gesundheit ein unwichtiges Spezialistenfeld<br />
sei und dass psychiatrische Dienste viel kosten und kaum etwas<br />
einbringen. Diese Denkweise führt dazu, dass Reformen im<br />
Bereich psychischer Gesundheit regelmäßig verschoben werden.<br />
Alternativ werden inselförmige Hilfsangebote für psychisch <strong>Kranke</strong><br />
formuliert, diese decken jedoch nicht den Bereich chronischer<br />
seelischer Erkrankungen ab, da sie nicht auf ein gemeindenahes Versorgungsnetz<br />
setzen.<br />
Insbesondere scheinen die Umstände in den osteuropäischen<br />
Ländern eine umfassende Veränderung des bestehenden psychiatrischen<br />
Gesundheitswesens nicht zuzulassen. Es wäre jedoch sinnvoll,<br />
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Reformkurs zu bringen und<br />
diese somit auf eine Zeit vorzubereiten, in der ein Wechsel zu einer<br />
gemeindenahen psychiatrischen Versorgungslandschaft möglich ist<br />
(4). Eine solche Entwicklung scheint auch unter den gegebenen unklaren<br />
Wirtschaftsbedingungen vernünftig und vielversprechend. Zum<br />
jetzigen Zeitpunkt sind jedoch die Verantwortlichen im Gesundheitswesen<br />
nicht bereit, innerhalb der osteuropäischen Länder die althergebrachten<br />
psychiatrischen Anstalten gegen ein gemeindenahes <strong>Psychiatrie</strong>versorgungssystem<br />
zu ersetzen. Ein Grund mag darin liegen,<br />
dass gemeindenahe <strong>Psychiatrie</strong> zwar ethisch korrekt ist, aber gleichzeitig<br />
die Schattenseiten der Wirtschaftslage und des gesellschaftlichen<br />
Miteinanders offenbaren würde. Das ungewisse Schicksal psychiatrischer<br />
Gesundheitsreformen in Osteuropa hat viel mit der jüngsten<br />
Vergangenheit dieses <strong>Teil</strong>s der Erde zu tun.<br />
Das Vermächtnis der Vergangenheit: ein schwieriger Bereich<br />
der osteuropäischen <strong>Psychiatrie</strong><br />
Das zwanghafte Streben nach Kontrollmöglichkeiten, welches totalitären<br />
Herrschaftssystemen eigen ist, findet sich auch teilweise in<br />
den Strukturen des psychiatrischen Gesundheitswesens in Osteuropa