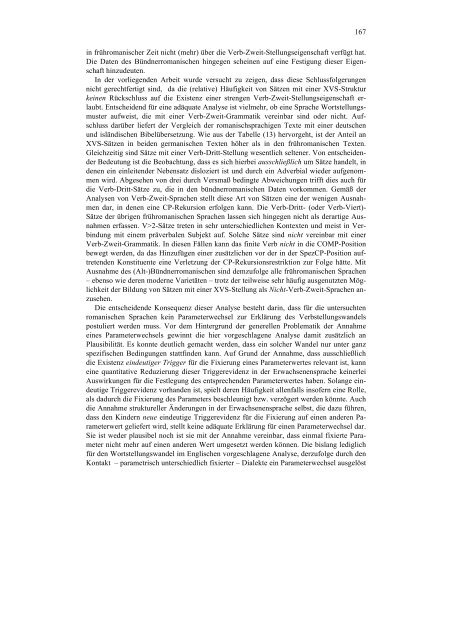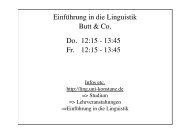Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
167<br />
in frühromanischer Zeit nicht (mehr) über die Verb-Zweit-Stellungseigenschaft verfügt hat.<br />
Die Daten des Bündnerromanischen hingegen scheinen auf eine Festigung dieser Eigenschaft<br />
hinzudeuten.<br />
In der vorliegenden Arbeit wurde versucht zu zeigen, dass diese Schlussfolgerungen<br />
nicht gerechtfertigt sind, da die (relative) Häufigkeit von Sätzen mit einer XVS-Struktur<br />
keinen Rückschluss auf die Existenz einer strengen Verb-Zweit-Stellungseigenschaft erlaubt.<br />
Entscheidend für eine adäquate Analyse ist vielmehr, ob eine Sprache Wortstellungsmuster<br />
aufweist, die mit einer Verb-Zweit-Grammatik vereinbar sind oder nicht. Aufschluss<br />
darüber liefert der Vergleich der romanischsprachigen Texte mit einer deutschen<br />
und isländischen Bibelübersetzung. Wie aus der Tabelle (13) hervorgeht, ist der Anteil an<br />
XVS-Sätzen in beiden germanischen Texten höher als in den frühromanischen Texten.<br />
Gleichzeitig sind Sätze mit einer Verb-Dritt-Stellung wesentlich seltener. Von entscheidender<br />
Bedeutung ist die Beobachtung, dass es sich hierbei ausschließlich um Sätze handelt, in<br />
denen ein einleitender Nebensatz disloziert ist und durch ein Adverbial wieder aufgenommen<br />
wird. Abgesehen von drei durch Versmaß bedingte Abweichungen trifft dies auch für<br />
die Verb-Dritt-Sätze zu, die in den bündnerromanischen Daten vorkommen. Gemäß der<br />
Analysen von Verb-Zweit-Sprachen stellt diese Art von Sätzen eine der wenigen Ausnahmen<br />
dar, in denen eine CP-Rekursion erfolgen kann. Die Verb-Dritt- (oder Verb-Viert)-<br />
Sätze der übrigen frühromanischen Sprachen lassen sich hingegen nicht als derartige Ausnahmen<br />
erfassen. V>2-Sätze treten in sehr unterschiedlichen Kontexten und meist in Verbindung<br />
mit einem präverbalen Subjekt auf. Solche Sätze sind nicht vereinbar mit einer<br />
Verb-Zweit-Grammatik. In diesen Fällen kann das finite Verb nicht in die COMP-Position<br />
bewegt werden, da das Hinzufügen einer zusätzlichen vor der in der SpezCP-Position auftretenden<br />
Konstituente eine Verletzung der CP-Rekursionsrestriktion zur Folge hätte. Mit<br />
Ausnahme des (Alt-)Bündnerromanischen sind demzufolge alle frühromanischen Sprachen<br />
– ebenso wie deren moderne Varietäten – trotz der teilweise sehr häufig ausgenutzten Möglichkeit<br />
der Bildung von Sätzen mit einer XVS-Stellung als Nicht-Verb-Zweit-Sprachen anzusehen.<br />
Die entscheidende Konsequenz dieser Analyse besteht darin, dass für die untersuchten<br />
romanischen Sprachen kein Parameterwechsel zur Erklärung des Verbstellungswandels<br />
postuliert werden muss. Vor dem Hintergrund der generellen Problematik der Annahme<br />
eines Parameterwechsels gewinnt die hier vorgeschlagene Analyse damit zusätzlich an<br />
Plausibilität. Es konnte deutlich gemacht werden, dass ein solcher Wandel nur unter ganz<br />
spezifischen Bedingungen stattfinden kann. Auf Grund der Annahme, dass ausschließlich<br />
die Existenz eindeutiger Trigger für die Fixierung eines Parameterwertes relevant ist, kann<br />
eine quantitative Reduzierung dieser Triggerevidenz in der Erwachsenensprache keinerlei<br />
Auswirkungen für die Festlegung des entsprechenden Parameterwertes haben. Solange eindeutige<br />
Triggerevidenz vorhanden ist, spielt deren Häufigkeit allenfalls insofern eine Rolle,<br />
als dadurch die Fixierung des Parameters beschleunigt bzw. verzögert werden könnte. Auch<br />
die Annahme struktureller Änderungen in der Erwachsenensprache selbst, die dazu führen,<br />
dass den Kindern neue eindeutige Triggerevidenz für die Fixierung auf einen anderen Parameterwert<br />
geliefert wird, stellt keine adäquate Erklärung für einen Parameterwechsel dar.<br />
Sie ist weder plausibel noch ist sie mit der Annahme vereinbar, dass einmal fixierte Parameter<br />
nicht mehr auf einen anderen Wert umgesetzt werden können. Die bislang lediglich<br />
für den Wortstellungswandel im Englischen vorgeschlagene Analyse, derzufolge durch den<br />
Kontakt – parametrisch unterschiedlich fixierter – Dialekte ein Parameterwechsel ausgelöst