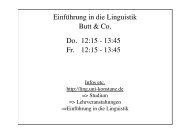Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Worte entsprechend seiner Vorstellungsfolge anordnen und den unmittelbaren Eindruck wiedergeben.<br />
Keine Regel hinderte ihn, die Satzglieder nach seinem Geschmack anzuordnen. Der Altfranzose<br />
hatte ein eigenes Stilideal, das er bald bewußt, bald unbewußt befolgte. (Blasberg 1937:1)<br />
Andere Autoren hingegen kommen zu einer grundsätzlich anderen Einschätzung der altfranzösischen<br />
Wortstellung. So kritisiert bereits Thurneysen (1892) die zahlreichen Studien<br />
zur Wortstellung im Altfranzösischen, die fast ausnahmslos dessen Wortstellungsfreiheit<br />
konstatieren. Demgegenüber kommt er an Hand einer Auswertung des Prosateils der<br />
Chantefable Aucassin et Nicolette zu dem Ergebnis, dass die altfranzösischen "Satztypen<br />
den neufranzösischen an Einförmigkeit eher voran- als nachstehen" (Thurneysen<br />
1892:289). Diese Diskrepanz seiner Ergebnisse zu denen der anderen Studien führt Thurneysen<br />
nicht auf Unterschiede der untersuchten Texte oder der Auszählungsmethoden zurück,<br />
sondern vielmehr darauf, dass der Schwerpunkt der meisten Untersuchungen darin<br />
besteht, die Stellung des finiten Verbs in Bezug auf andere Satzglieder zu betrachten, ohne<br />
dabei aber "auf den Platz, den es im Satze überhaupt einnimmt" zu achten (Thurneysen<br />
1892:289). 12 Betrachtet man nämlich die Stellung des finiten Verbs im Satz, so kann nach<br />
Ansicht von Thurneysen von einer Stellungsfreiheit oder gar Regellosigkeit keine Rede<br />
sein. Vielmehr konstatiert Thurneysen (1892:289) als Ergebnis seiner Studie, dass "im Prosatexte<br />
von ,Aucassin und Nicolete‘ [...] die Stellung des Verbum finitum sozusagen völlig<br />
fest ist und einheitlichen Prinzipien folgt".<br />
Damit gebührt Thurneysen zweifelsohne "[d]as Verdienst, die feste Stellung des Verbums<br />
und infolgedessen seine Wichtigkeit für den Gesamtbau des Satzes erkannt zu haben"<br />
(Meyer-Lübke 1899:798). Thurneysens Studie muss als die Pionierarbeit zur Stellung des<br />
finiten Verbs in den frühromanischen Sprachen angesehen werden. Für eine Untersuchung,<br />
wie die hier vorgelegte, die die Stellung des finiten Verbs innerhalb des Satzgefüges zum<br />
Thema hat, ist sie von immenser Wichtigkeit. Auch in anderer Hinsicht hebt sich Thurneysens<br />
Studie von den meisten anderen ab. Sie ist nämlich eine der wenigen traditionellen<br />
Wortstellungsuntersuchungen, die nicht lediglich umfangreiche Beispiellisten zur Illustration<br />
verschiedener Wortstellungsmuster enthält. Vielmehr werden an Hand eines kurzen<br />
Textausschnittes die Wortstellungsverhältnisse exemplarisch dargestellt und die Beispiele<br />
in – lediglich drei – klar definierte Klassen unterteilt. Die Beispiele dienen nicht zur Illustration<br />
der angeblichen Vielseitigkeit des Altfranzösischen, sondern dazu, eine eingangs<br />
explizit formulierte These zu belegen. Damit unterscheidet sich Thurneysens Argumentationsweise<br />
sehr stark von derjenigen der meisten anderen bisher besprochenen Arbeiten.<br />
Dieser radikale Unterschied in der Forschungs- und Argumentationsweise dürfte auch<br />
ein Grund dafür sein, dass sich die Hoffnung von Thurneysen (1892:289), dass seine –<br />
durch Wackernagels Aufsatz von 1892 angeregte – Studie "dem einen oder dem anderen<br />
bei weiteren Forschungen dienen möge", offenbar nur in sehr begrenztem Maße erfüllt hat.<br />
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie etwa Meyer-Lübke (1899), Richter (1903), bleibt<br />
seine Arbeit in den nachfolgenden Wortstellungsuntersuchungen weitgehend unberücksichtigt.<br />
13<br />
12 Weitere Gründe für die Unterschiede sieht Thurneysen (1892:289) darin, dass viele Studien auf<br />
poetischen Texten basieren oder Haupt- und Nebensätze getrennt behandeln und dadurch "so eng<br />
zusammengehörendes" auseinanderreißen.<br />
13 Zu den wenigen, die Thurneysens Arbeit würdigend erwähnen, gehört auch Wartburg (1946).<br />
Obwohl er, wie bereits gesehen, von einer großen Freiheit der altfranzösischen Wortstellung<br />
75