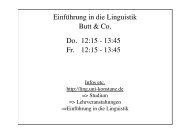Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
84<br />
gen lateinischen Kopula auch für die Kopula des Altfranzösischen Gültigkeit hatte (cf. auch<br />
Meyer-Lübke 1899:773) und allmählich auch auf Verben mit stärkerer Betonung übertragen<br />
worden ist:<br />
Im Altfranzösischen steht das Verbum finitum unmittelbar hinter dem ersten Satzgliede, wenn dieses<br />
vollbetont ist (oder in einer älteren Sprachperiode vollen Ton tragen konnte); sonst reiht es sich<br />
dem nächsten volltonigen Satzgliede an. (Thurneysen 1892:300)<br />
Evidenz für diese Annahme der ursprünglichen enklitischen Bindung der finiten Verben<br />
sieht Thurneysen (1892:303) in der heutigen engen Bindung zwischen finitem Verb und<br />
klitischen (Objekts-)Pronomina. Dadurch nämlich, dass Objektsklitikon und Verb diesselbe<br />
Stelle anstrebten, konnten seiner Ansicht nach "die zufällig neben einander gerathenen<br />
Pronomina und Verba so eng mit einander verwachsen [...], daß, so oft das Verbum diesen<br />
seinen Platz verläßt, es das Pronomen an andere Satzstellen mit sich fortreißt". Meyer-<br />
Lübke (1899:798) hält diesen Hinweis auf die unbetonten Objektspronomina jedoch nicht<br />
für überzeugend, "denn bei ihnen hält das Romanische nur fest, was schon lateinischer<br />
Brauch war, macht sich sogar allmählich davon frei, wogegen die Stellung des Verbums<br />
eine Neuerung ist". Thurneysen (1892:305) räumt ein, dass die von ihm formulierte Regel,<br />
"im Altfranzösischen stelle sich das Verbum hinter den ersten betonten Satzteil, nicht genau<br />
ist, auch in keiner Periode für alle Sätze gegolten hat, sondern nur auf den Grundstock von<br />
Satztypen passt, welcher dem Bau der andern als Muster diente". Rhythmische Faktoren<br />
waren seiner Ansicht nach lediglich der Auslöser für die Entstehung der festen Verbstellung<br />
im Altfranzösischen, wo "der Rhythmus aufgehört [hatte] die bestimmende Rolle zu spielen"<br />
(Thurneysen 1892:304). 20<br />
Auch Herman (1954) weist diese Analogieerklärung Thurneysens zurück. Sie ist seiner<br />
Ansicht nach "nullement confirmée par les textes" (Herman 1954:250,Fn.15). Außerdem<br />
hält Herman (1954:250,Fn.15) es für "peu vraisemblable que les règles de position valables<br />
pour le seul verbe copule aient pu s'étendre à des verbes accentués et à sémantisme plein".<br />
In diesem Zusammenhang weist Herman auf ein gravierendes Problem bei der Übernahme<br />
des Wackernagel'schen Gesetzes zur Erklärung der Verbstellung im Altfranzösischen hin.<br />
Denn anders als die schwachtonigen Klitika steht das finite Verb nicht unmittelbar hinter<br />
dem ersten betonten Wort, sondern hinter dem ersten Satzglied:<br />
Il faut dire aussi que le premier terme de la proposition (Thurneysen, en effet, parle de «Satzglied»<br />
et non pas de mots) peut être composé lui-même de plusieurs mots accentués; dans ces cas, le<br />
verbe suit le groupe tout entier et non pas le premier mot accentué du groupe: il est clair que la<br />
phonétique syntaxique n'explique pas en elle-même sa position. (Hermann 1954:250,Fn.15)<br />
Obwohl somit die Rolle der rhythmischen Faktoren in den verschiedenen traditionellen Arbeiten<br />
sehr unterschiedlich bewertet wird, besteht weitgehend Übereinstimmung in der Einschätzung,<br />
dass diese Faktoren für die altfranzösische Wortstellung von großer Relevanz<br />
waren. Einigkeit herrscht vor allem in der Auffassung, dass im Altfranzösischen die Wörter<br />
20 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Biener (1922, 1926) eine ähnliche Erklärung für<br />
die Entstehung der Verb-Zweit-Stellung im Deutschen liefert. Ebenso wie Thurneysen für das<br />
Französische annimmt, geht Biener (1926:256) davon aus, dass die deutsche Verb-Zweit-Stellung<br />
auf "verbenklise" beruht, wobei "später [...] analogische ausbreitung eine wichtige rolle" spielt.<br />
Die endgültige Durchsetzung dieser Stellungsregel ist allerdings, so vermutet Biener (1922:177),<br />
"erst durch die theoretische grammatik und die strenge schulzucht erreicht worden".