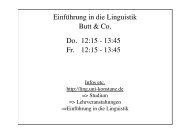Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
chen Rhythmuslinie "sowohl für die gefühlsmäßige als für die berichtende Rede" (Richter<br />
1920:36). Die Folge ist die, dass dem ursprünglich fallenden Rhythmus nun die "psychologisch<br />
steigende Anordnung" entgegengestellt wird (Richter 1920:37). Damit ist offenbar<br />
gemeint, dass aus dem "Bedürfnis nach gefühlserregender Heraushebung" es zur<br />
"Anwendung neuer Stellungen" kommt, die wiederum "neue Rhythmuslinien" hervorbringen<br />
(Richter 1920:37). Unklar ist, inwiefern diese Schlussfolgerung die tatsächliche Ansicht<br />
Richters wiedergibt. Ihre Ausführungen sind derart unpräzise und teilweise auch widersprüchlich,<br />
dass es kaum möglich ist, die Grundaussagen klar herauszuarbeiten. Auch<br />
Lerch weist auf einige Widersprüche in Richters Aussagen hin. Für ihn stellt sich die Frage,<br />
wie es überhaupt zur Bildung eines steigenden Rhythmus kommen konnte, "da doch nach<br />
ihrer Meinung der fallende Rhythmus schon fest eingeprägt ist, bevor der Einzelne überhaupt<br />
beginnt, rücksichtsvolle Reden zu bilden" (Lerch 1934:282). Nach Ansicht von<br />
Lerch (1934:282) kann es hier eine 'rücksichtsvolle' Rede, die mit der Hauptvorstellung<br />
beginnt, gar nicht geben, denn dann wäre sie "eben keine rücksichtsvolle Rede mehr, sondern<br />
impulsive".<br />
Aber auch Lerchs Analyse ist nicht frei von Widersprüchen. In der Diskussion der Analyse<br />
Richters kritisiert er heftig deren Annahme, dass bereits das Altfranzösische einen "fast<br />
ganz steigenden Rhythmus" aufwies (Richter 1920:34). Dagegen führt Lerch (1934:283)<br />
eine Reihe von Belegen aus dem Altfranzösischen mit fallendem Rhythmus an und betont,<br />
dass "im Altfranzösischen [...] die fallenden Stellungen zahlreicher als im Neufranzösischen<br />
und im neuesten Französisch" sind. Gleichzeitig betont er jedoch, dass "im Französischen<br />
von Anfang an der steigende" Rhythmus vorherrschte (Lerch 1934:286). Evidenz<br />
für diese Annahme sieht er darin, dass die 'druckschwachen' Objektspronomina bereits im<br />
Altfranzösischen normalerweise unmittelbar vor dem finiten Verb standen (Le père<br />
m'aime), im Lateinischen hingegen meist dahinter am Satzende (Pater amat me). Lerch<br />
wendet sich in diesem Zusammenhang gegen die so genannte 'Enklisentheorie', die besagt,<br />
dass in den frühromanischen Sprachen die schwachtonigen Elemente regelmäßig die zweite<br />
Position im Satz einnehmen und enklitisch an das vorstehende Element gebunden sind<br />
(Meyer-Lübke 1897, Melander 1936). Damit wird versucht, der von Tobler (1912:400) und<br />
Mussafia (1896) konstatierten Tatsache gerecht zu werden, dass in allen frühromanischen<br />
Sprachen unbetonte Elemente nicht an der Spitze des Satzes stehen können ('Tobler-<br />
Mussafia-Gesetz'). Der Analyse von Meyer-Lübke (1897) zufolge kommt es im Altfranzösischen<br />
erst allmählich ab dem 13. Jhdt. zur Aufgabe dieser Beschränkung. Dies wurde<br />
seiner Ansicht nach zum einen "dadurch ermöglicht [...], daß auf verschiedene Weise schon<br />
andere Wörter, die Präpositionen, die Subjektspronomina, der Artikel u.a., proklitisch geworden<br />
waren" und zum anderen dadurch, dass "der Satzrhythmus bis auf einen gewissen<br />
Grad crescendo, nicht mehr decrescendo oder nicht mehr trochäisch-daktylisch, sondern<br />
jambisch-anapästisch war" (Meyer-Lübke 1897:334). Lerch hingegen kann im Rahmen<br />
seiner Analyse, in der er nicht von einem solchen Rhythmuswandel ausgeht, die Klitika-<br />
Stellung im Altfranzösischen nur durch eine ad hoc-Annahme erklären. Er nimmt an, dass<br />
man es im Altfranzösischen "[o]ffenbar liebte [...], den Satz mit einem druckstarken Wort<br />
zu eröffnen", obwohl "der Vers als Ganzes schon im Altfranzösischen steigenden Rhythmus"<br />
hat (Lerch 1934:299).<br />
Thurneysen (1892) knüpft ebenfalls an die Enklisentheorie an, um die seiner Ansicht<br />
nach feste Verbstellung des Altfranzösischen zu begründen. Seine These lautet, dass das<br />
von Wackernagel (1892:428) beobachtete enklitische Stellungsverhalten der schwachtoni-<br />
83