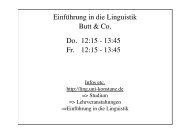Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
und Satzglieder sehr häufig "ohne Rücksicht auf ihre logische Zusammengehörigkeit, lediglich<br />
nach rhythmischen Prinzipien geordnet" sind (Lerch 1934:349). Das heißt, die Anordnung<br />
erfolgt im alternierenden Wechsel zwischen druckstarken und druckschwachen<br />
Silben, Wörtern oder Satzteilen. Im Neufranzösischen ist Lerch (1934:352) zufolge eine<br />
solche spezifisch-rhythmische Anordnung von Satzgliedern weitgehend auf die Poesie<br />
beschränkt und "im allgemeinen nur statthaft, wenn sie nicht in allzu auffälligem Widerspruch<br />
mit der logischen Anordnung steh[t]".<br />
3.3.3.3 Logisch-grammatische Faktoren<br />
Diese Schlussfolgerung Lerchs steht stellvertretend für die in sehr vielen traditionellen Arbeiten<br />
verbreitete Auffassung, wonach so genannten 'logisch-grammatischen' Faktoren die<br />
ausschlaggebende Rolle für den Wortstellungswandel im Französischen zugestanden wird.<br />
Dahinter steht die Ansicht, dass durch die Übernahme einer angeblich logisch-reflektierten<br />
Denkweise das Französische seine "Periode der Primitivität" überwinden konnte, in der<br />
sich "[d]er Geist [...] noch auf einer [...] tiefen Entwicklungsstufe" befand und der "Einfluß<br />
der impulsiven, aber auch der rhythmischen Wortstellung" im Vordergrund stand (Koch<br />
1934:82). Entscheidender Anteil daran, dass sich diese Denkweise durchsetzen konnte, wird<br />
den Grammatikern und Sprachpuristen des 16. und insbesondere 17. Jhdts., wie Malherbe<br />
oder Vaugelas, zugestanden. Geprägt war deren Arbeit durch das Bemühen, die französische<br />
Sprache zu standardisieren und zu normieren. 21 Hierzu gehörte auch der Versuch, die<br />
Wortstellung zu fixieren. Diesem Versuch liegt die Annahme zugrunde, dass "eine geregelte<br />
Wortstellung [...] eine große Erleichterung für den Hörer oder Leser" bedeutet, weil<br />
der Sprecher seinen "individuellen Ausdruckswillen" nicht mehr so stark entfalten kann und<br />
damit automatisch mehr Rücksicht auf den Hörer bzw. Leser nimmt (Lerch 1934:250f.).<br />
Wichtigstes Ziel war das Erreichen einer größtmöglichen "clarté de la langue" (Ling<br />
1866:II), die unter anderem auch durch die 'logische' Anordnung der Satzglieder erreicht<br />
werden sollte:<br />
Il est évident que [...] l'ordre logique est la construction qui favorise le plus la clarté, ou plutôt, que<br />
la langue dont la construction s'en rapproche le plus, est aussi la plus claire de toutes. (Ling<br />
1866:III)<br />
Die genaue Bestimmung dieser 'logischen' Anordnung erweist sich allerdings als sehr problematisch<br />
und widersprüchlich. Generell wird davon ausgegangen, dass sich die Zusammenknüpfung<br />
des 'Logisch-Zusammengehörigen' in der Subjekt-Verb-Objekt-Stellung<br />
manifestiert:<br />
21 Wartburg (1946:170f.) beispielsweise spricht davon, dass es Malherbe darum ging, die französische<br />
Sprache zu "dégasconner" und zu "débarasser [...] de ses scories". In seiner ihm eigenen pathetischen<br />
Sprache bezeichnet er Malherbe gar als den Mann "dont la France avait besoin à ce<br />
moment-là", um schließlich zu folgendem Schluss zu gelangen:<br />
"La nation désirait que quelqu'un lui donnât une norme pour sa langue; elle était toute préparée à<br />
recevoir une loi en fait de grammaire. Plus que la personne de Malherbe c'était le génie du peuple<br />
français qui se donnait à lui-même les nouvelles règles." (Wartburg 1946:171)<br />
85