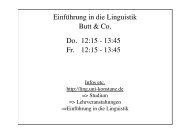Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Text V1 V2 V>2<br />
SV(X) XVS<br />
rol 11% 54% 20% 15%<br />
Tabelle (3): Prozentualer Anteil der Verbstellungsmuster der ersten 100 Matrixsätze mit realisiertem<br />
Subjekt (nach Kaiser 2000:16f.)<br />
Diese von der Roberts'schen Auszählung teilweise sehr stark divergierenden Ergebnisse<br />
lassen sich meiner Ansicht nach nur dadurch erklären, dass Roberts entsprechend der von<br />
ihm gegebenen Interpretation der Daten offenbar nur solche Fälle als V>2 Sätze rechnet, in<br />
denen das Subjekt dem Verb (unmittelbar) folgt. Solche Sätze wie in (30), in denen das<br />
Subjekt – zusammen mit einer oder mehreren weiteren Konstituenten – dem Verb voransteht,<br />
werden offensichtlich nicht berücksichtigt.<br />
Ein weiteres empirisches Manko der Analyse von Roberts besteht darin, dass keine Unterscheidung<br />
zwischen Prosa- und Nicht-Prosa-Texten vorgenommen wird. Wie bereits<br />
erwähnt, entspricht dies der üblichen Praxis vieler – insbesondere generativer – Untersuchungen<br />
des syntaktischen Wandels. Auffallend ist, dass Roberts offensichtlich auch bei<br />
der Analyse von Aucassin et Nicolete nicht zwischen den prosaischen und lyrischen Kapiteln<br />
unterscheidet. Dies ist vor allem deshalb zu kritisieren, weil – wie bereits Thurneysen<br />
(1892:296) in seiner Untersuchung dieses Textes überzeugend nachweist – gerade der<br />
Vorteil in der Analyse dieser Chantefable darin besteht, dass sich dabei "die seltene Gelegenheit<br />
[bietet] zu konstatieren, wie sich die poetische Sprache eines mittelalterlichen<br />
Dichters zu den herrschenden Sprachgewohnheiten verhielt". Thurneysens Beobachtungen<br />
zufolge zeigt sich deutlich, dass in den poetischen Abschnitten des Textes "sämtliche<br />
Hauptregeln der Verbalstellung ohne Scheu bei Seite geworfen werden" (Thurneysen<br />
1892:296). Folglich ist eine Analyse, die diese Abschnitte nicht gesondert betrachtet, weder<br />
in der Lage, diesen Tatbestand überhaupt zu erkennen, noch geeignet, die "herrschenden<br />
Sprachgewohnheiten" herauszuarbeiten.<br />
Es sollte also klar geworden sein, dass eine empirische Datenanalyse, wie sie von Roberts<br />
(1993) vorgelegt und wie sie in vielen anderen generativen Untersuchungen in ähnlicher<br />
Weise vorgenommen wird, nicht geeignet sein kann, eine adäquate Antwort auf die<br />
Frage nach der Verb-Zweit-Stellungseigenschaft des Altfranzösischen sowie anderer altromanischer<br />
Sprachen zu finden. Bevor eine solche Analyse vorgelegt wird, die diesen Anforderungen<br />
gerecht zu werden versucht, sollen im Folgenden zunächst die hier vorgestellten<br />
Untersuchungen dahingegehend betrachtet werden, wie der Wandel der Verbstellung im<br />
Französischen zu erklären versucht wird.<br />
3.3.3 Traditionelle Erklärungsansätze<br />
Die bisherige Darstellung der traditionellen Wortstellungsanalysen hat gezeigt, dass die Untersuchungen<br />
des 19. Jhdts. und des frühen 20. Jhdts. zur Wortstellung im Französischen<br />
primär deskriptiv ausgerichtet sind. Erst in den Arbeiten aus den 30er und 40er Jahren werden<br />
verstärkt mögliche Gründe der Entstehung und der Entwicklung der französischen<br />
Wortstellung und insbesondere der Subjekt-Verb-Inversion erörtert. Viele der dabei vorgeschlagenen<br />
Erklärungsansätze sind eingebettet in den theoretischen Rahmen des – an Wilhelm<br />
von Humboldt anknüpfenden – Idealismus von Karl Voßler oder der Völkerpsycholo-<br />
79