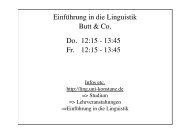Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10<br />
sind (negative Evidenz). Dennoch sind sie innerhalb kurzer Zeit in der Lage, korrekte Sätze<br />
in ihrer Muttersprache zu bilden und zu verstehen und nicht korrekte Sätze als ungrammatisch<br />
zu beurteilen.<br />
Erklärtes Ziel der generativen Grammatik ist es, eine Erklärung für dieses 'logische Problem<br />
des Spracherwerbs' zu finden. 3 Es geht also darum, diejenigen Regeln und Prinzipien<br />
zu formulieren, die den kindlichen Erwerb jeder menschlichen Sprache gewährleisten. Auf<br />
Grund der beschriebenen Spracherwerbsproblematik muss die Vielfalt dieser Regeln und<br />
Prinzipien möglichst restriktiv gehalten werden. Sie muss aber gleichzeitig groß genug sein,<br />
um die grammatischen Gemeinsamkeiten aller Sprachen zu erfassen. Neben diesen universalgrammatischen<br />
Regeln und Prinzipien gibt es darüber hinaus auch grammatische Eigenschaften<br />
von Sprachen, durch die nicht alle, jedoch mehrere Sprachen gekennzeichnet sind.<br />
Um dies zu erfassen, wird angenommen, dass die Universalgrammatik neben den besagten<br />
Regeln und Prinzipien Strukturoptionen ('Parameter') zur Verfügung stellt, deren Wert für<br />
jede Einzelsprache gesondert festgelegt ist. Dieser Wert besagt, ob eine Sprache eine (oder<br />
mehrere) bestimmte Eigenschaft(en) besitzt oder nicht. Im Verlauf des Spracherwerbs muss<br />
das Kind auf Grund der ihm zugänglichen Sprachdaten ('Input') für die verschiedenen Parameter<br />
den jeweiligen Wert, der für seine Muttersprache in Frage kommt, festlegen. Entscheidend<br />
ist hierbei vor allem die Annahme, dass diese Parameterfixierung den Erwerb<br />
mehrerer Eigenschaften, die gebündelt mit einem Parameterwert verbunden sind, impliziert.<br />
Das bedeutet, dass Kinder diese Eigenschaften nicht separat und nacheinander erlernen<br />
müssen, sondern dass diese mit der Festlegung des betreffenden Parameters auf einen<br />
bestimmten Wert gleichzeitig und 'automatisch' in die Grammatik integriert werden.<br />
Im Zusammenhang mit dem von Chomsky (1995) entworfenen 'Minimalistischen Programm'<br />
ist die Diskussion der Parameter stark in den Hintergrund getreten. Da jedoch das<br />
Minimalistische Programm in die generative Prinzipien- und Parametertheorie eingebettet<br />
ist, bedeutet dies keineswegs eine Aufgabe der Parametertheorie, sondern lediglich eine<br />
Verschiebung des Schwerpunkts der aktuellen generativen Grammatikdiskussion. Im Zentrum<br />
stehen gegenwärtig vorwiegend technische Fragen bzgl. des Aufbaus und der Funktionsweise<br />
universal- und einzelsprachlicher Regeln und Prinzipien. Ausgelöst durch die<br />
Arbeiten von Pollock (1989) und Chomsky (1991) ist eine intensive Diskussion über Art<br />
und Anzahl funktionaler Kategorien entstanden. Obwohl gegen die Einführung zusätzlicher<br />
funktionaler Kategorien neben den Kategorien INFL und COMP zahlreiche und gut begründete<br />
Einwände vorgebracht wurden (Iatridou 1990, Abeillé / Godard 1994, Meisel<br />
1994), ist die Annahme der INFL-Aufspaltung in mehrere funktionale Kategorien sowie die<br />
Einführung einer Neg(ations)-Phrase oder einer D(eterminierer)-Phrase weitgehend akzeptiert<br />
worden. Etwas umstrittener ist die Annahme einer in mehrere funktionale Kategorien<br />
unterteilten CP (Müller / Sternefeld 1993, Rizzi 1997).<br />
In der vorliegenden Untersuchung wird dennoch davon ausgegangen, dass auf die Annahme<br />
solcher zusätzlicher funktionaler Kategorien verzichtet werden kann, um die hier<br />
untersuchten Verb-Zweit-Stellungseffekte zu erfassen. Es wird angenommen, dass es möglich<br />
ist, auf der Grundlage eines Phrasenstrukturbaums, der lediglich die beiden funktiona-<br />
3 Chomsky (1986b:xxvii) sieht darin einen Sonderfall von 'Platons Problem', das darin besteht zu<br />
erklären, "how we know so much, given that the evidence available to us is so sparse".