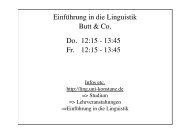Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
12<br />
len. Sie geht auf den Junggrammatiker Hermann Paul zurück, der als einer der ersten auf<br />
die Bedeutung des Spracherwerbs für den Sprachwandel aufmerksam gemacht hat:<br />
Es liegt auf der Hand, dass die Vorgänge bei der Spracherlernung von der allerhöchsten<br />
W ichtigkeit für die Erklärung der Veränderung des Sprachusus sind, dass<br />
sie die wichtigste Ursache für diese Veränderungen abgeben. Wenn wir, zwei durch einen längeren<br />
Zwischenraum von einander getrennte Epochen vergleichend, sagen, die Sprache habe sich in den<br />
Punkten verändert, so geben wir ja damit nicht den wirklichen Tatbestand an, sondern es verhält<br />
sich vielmehr so: die Sprache hat sich ganz neu erzeugt und diese Neuschöpfung ist nicht völlig<br />
übereinstimmend mit dem Früheren, jetzt Untergegangenen ausgefallen. (Paul 1920:34)<br />
Nach Auffassung von Paul (1920:34) können diese Vorgänge im Spracherwerb "entweder<br />
positiv oder negativ sein, d.h. sie bestehen entweder in der Schöpfung von etwas Neuem<br />
oder in dem Untergang von etwas Altem, oder endlich drittens sie bestehen in einer Unterschiebung,<br />
d.h. der Untergang des Alten und das Auftreten des Neuen erfolgt durch den<br />
selben Akt". Paul macht allerdings keinerlei konkrete Angaben über das Funktionieren<br />
dieser Spracherwerbsmechanismen und lässt die Frage offen, warum es dabei zu Veränderungen<br />
der Muttersprache kommen kann (cf. Weinreich / Labov / Herzog 1968:109).<br />
Einen Versuch, diese Frage zu beantworten, stellt das von Andersen (1973) entwickelte<br />
Sprachwandelmodell dar. Dieses Modell, das weitgehend in alle modernen Sprachwandeltheorien<br />
Eingang gefunden hat 5 , basiert auf der Annahme, dass Kinder keinen direkten Zugang<br />
zur "internalized grammar" der erwachsenen Sprecher ihrer Muttersprache haben.<br />
Stattdessen muss das Kind auf der Grundlage des erwachsenensprachlichen Inputs ("Output<br />
1") und unter Mitwirkung der von der Universalgrammatik vorgegebenen Regeln und<br />
Prinzipien die Grammatik der Erwachsenensprache rekonstruieren (Andersen 1973:767,<br />
Anttila 1989:197):<br />
(26)<br />
Universalgrammatik<br />
Grammatik der Erwachsenen Grammatik der Kinder<br />
Erwachsenensprache ('Output 1') Kindersprache ('Output 2')<br />
Zu einem Wandel des grammatischen Systems einer Sprache kann es diesem Modell zufolge<br />
dann kommen, wenn Kinder die Daten des erwachsenensprachlichen Inputs in einer<br />
anderen Weise interpretieren als in der im Grammatiksystem der Erwachsenen vorgegebenen<br />
Weise. Das heißt, "eine von den bisher üblichen Grammatiken abweichende neue<br />
Grammatik wird konstruiert", wobei "die sich aus ihr ergebende Sprechtätigkeit [...] von<br />
der bisherigen Sprechtätigkeit verschieden sein [kann], [...] es aber nicht [muß]" (Bechert<br />
1982:207). Gemäß der klassischen Definition von Reanalyse, die auf Langacker (1977:58)<br />
5 Andersens Modell diente ursprünglich nur der Erklärung von phonologischem Wandel (in einem<br />
tschechischen Dialekt in Nordostböhmen). Es wurde erst später zur Erklärung von syntaktischem<br />
Wandel herangezogen (für eine kritische Darstellung des Andersen'schen Modells cf. Bechert<br />
1982 und Anttila 1989:196ff.).