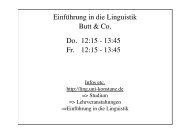Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
80<br />
gie von Wilhelm Wundt. Die früheren Analysen und Erklärungsversuche orientieren sich<br />
größtenteils an den Prinzipien und theoretischen Grundannahmen der vor allem die<br />
<strong>Sprachwissenschaft</strong> des 19. Jhdts. dominierenden positivistischen Schule der Jungrammatiker,<br />
deren wichtigster romanistischer Vertreter Wilhelm Meyer-Lübke war.<br />
Beide Schulen gehen von einer grundsätzlich verschiedenen Konzeption von <strong>Sprachwissenschaft</strong><br />
aus, die daher resultiert, dass der Untersuchungsgegenstand, die menschliche<br />
Sprache, vollkommen unterschiedlich aufgefasst wird. In klarer Abgrenzung zu den Junggrammatikern<br />
wird in den idealistischen und psychologischen Theorieansätzen Sprache<br />
nicht als ein "durch ausnahmelose Naturgesetze starr gebundenes System" angesehen, sondern<br />
als etwas, das "in das Gebiet freier, vom Willen sprachbildender Individuen abhängiger<br />
Schöpfung gehört" (Haarhoff 1936:5). Sprachliche Strukturen werden nach dieser Auffassung<br />
als Spiegelbild der 'Psyche' oder psychischen Verfassung des Menschen, d.h. des<br />
Sprechers, angesehen. Es wird behauptet, dass sie den 'Geist' und die 'Begabung' des Volkes<br />
des jeweiligen Sprechers erkennen lassen und ihre "mannigfachen Veränderungen [...]<br />
dem Wandel in Geistesart und Denkweise der Völker unterworfen" sind (Haarhoff<br />
1936:5). 14 Es ist heute – zu Recht – vollkommen undenkbar, diese Begriffe vorbehaltlos zu<br />
gebrauchen, geschweige denn sie in einer wissenschaftlichen Argumentation zu übernehmen.<br />
Da die Völkerpsychologie und der Idealismus aber vor allem in der ersten Hälfte des<br />
20. Jhdts. die Wortstellungsdebatte in der deutschen Romanistik sehr stark prägten, sollen<br />
die Erklärungsversuche im Rahmen dieser Theorien hier kurz vorgestellt werden. 15<br />
Die bei weitem umfassendste Darstellung dieser und anderer Erklärungsansätze der<br />
Wortstellung im Französischen gibt Lerch (1934) im dritten Band seiner umfangreichen<br />
'Historischen französischen Syntax'. Er referiert hierbei neben seinen eigenen Arbeiten<br />
(Lerch 1922) vor allem die Untersuchungen von Richter (1903, 1920), Blinkenberg (1928)<br />
und Kuttner (1929). 16 Die diesen Arbeiten gemeinsame Grundannahme ist die, dass die<br />
Wortstellung innerhalb eines Satzes (in einer gegebenen Sprache) durch verschiedene Faktoren<br />
bestimmt wird, die nebeneinander und teilweise auch gegeneinander wirken (Lerch<br />
1934:249). Der Sprecher hat demnach bei der Äußerung eines Satzes prinzipiell die Möglichkeit,<br />
sich zwischen diesen Faktoren zu entscheiden, was entsprechende Auswirkungen<br />
14 Diese enge Verknüpfung zwischen 'Sprache' und 'Volk' wird außerdem noch qualitativ bewertet,<br />
wie das Zitat aus Voßlers "umwälzender Kampfschrift" (Siepmann 1937:2) gegen die "Afterwissenschaft<br />
des radikalen Positivismus" (Voßler 1904:4) belegt:<br />
"Die Erfahrung lehrt [...]: je begabter und je zivilisierter ein Volk, desto vollkommener seine Sprache,<br />
desto klarer und sicherer seine Grammatik, desto schärfer und feiner nuanciert sein Lexikon.<br />
Zweifellos!" (Voßler 1904:90)<br />
15 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Ansätze keineswegs nur von (späteren) Anhängern<br />
oder Mitläufern der nationalsozialistischen Ideologie vertreten wurden, sondern auch von<br />
solchen, die von den Nationalsozialisten verfolgt oder sogar umgebracht wurden (z.B. Victor<br />
Klemperer, Max Kuttner oder Elise Richter). Erschreckend ist freilich, dass es für manche erst der<br />
Katastrophe bedurfte, um zu merken, wie unsinnig (und gefährlich) die "Wisssenschaft" war, die<br />
sie vertraten:<br />
"Ich glaube nicht mehr an die Völkerpsychologie. Alles, was ich für undeutsch gehalten habe,<br />
Brutalität, Ungerechtigkeit, Heuchelei, Massensuggestion bis zur Besoffenheit, alles das floriert<br />
hier." (Victor Klemperer, Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941. Hrsg.<br />
v. W. Nowojski, Berlin: Aufbau-Verlag 1995, S.18, Tagebucheintrag vom 3.4.1933).<br />
16 Einen sehr guten Überblick über diese Wortstellungsdiskussion liefert auch Kellenberger (1932).