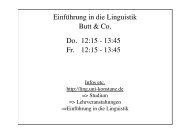Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
88<br />
3.3.3.4 Morphosyntaktische Faktoren<br />
Wie bereits in Abschnitt 3.2 kurz erwähnt, macht Diez (1882:1092) für den Wandel der<br />
Wortstellung bei der Herausbildung der romanischen Sprachen aus dem Lateinischen vor<br />
allem den "Verlust der Casusflexion" verantwortlich, "welcher ihnen der in diesem Puncte<br />
fast schrankenlosen Freiheit der classischen Schreibart zu folgen verbot". Im Altfranzösischen<br />
ist die Nominalflexion allerdings noch in reduzierter Form als Zwei-Kasus-Flexion<br />
erhalten geblieben, was in vielen Analysen des Altfranzösischen als Grund für die vermeintliche<br />
Freiheit der Stellung der Nominalkonstituenten gesehen wird. Entsprechend<br />
wird die Fixierung der Wortstellung auf den Verlust der Nominalflexion zurückgeführt.<br />
Einer der ersten, der diesen Zusammenhang formuliert, ist Le Coultre (1875:7):<br />
En effet, le français moderne ne pouvant plus distinguer par la flexion le sujet de l'objet, sera forcé<br />
de les distinguer par la place des termes: de là, un ordre des mots presque invariable. Le vieux<br />
français avait deux cas, le nominatif et l'accusatif, dont le premier subsista jusqu'au XIV e siècle.<br />
Seither ist diese These vielfach wiederholt worden (Meyer-Lübke 1899:797f., Foulet<br />
1928:37f., Brunot / Bruneau 1949:485). Gleichzeitig ist aber in sehr vielen traditionellen<br />
Arbeiten aber auch heftig dagegen argumentiert worden (Lerch 1934:267, Wundt 1912:377,<br />
Kuttner 1929:19). Lerch (1934:267-270) stellt einige der wichtigsten Argumente gegen die<br />
"irrige Meinung" zusammen, dass der Wortstellungswandel im Französischen auf den<br />
Verlust des Zweikasussystems zurückzuführen sei. Das überzeugendste Argument ist zweifellos<br />
der Hinweis darauf, dass sich die strenger festgelegte Wortstellung erst im 16. Jhdt.<br />
allmählich durchzusetzen beginnt, also zwei Jahrhunderte nachdem das Zweikasussystem<br />
aufgegeben worden ist bzw. sich die letzten Spuren des Zweikasussystems nachweisen<br />
lassen. Lerch weist außerdem darauf hin, dass im Altfranzösischen nur bei maskulinen<br />
Nomina eine formale Unterscheidung zwischen Rektus und Obliquus existierte. Dennoch<br />
war im Altfranzösischen die Bildung von Sätzen wie La rose la reïne prent oder La reïne la<br />
rose prent möglich, obwohl weder aus der Kasusmarkierung noch der Wortstellung hervorgeht,<br />
welches der Nomina die Subjekt- bzw. Objektsfunktion trägt. Ein weiteres Argument<br />
von Lerch ist der Hinweis auf andere romanische Sprachen, wie das Spanische oder Italienische,<br />
die "von Anfang an keinen Unterschied zwischen Subjekts- und Objektskasus besitzen<br />
und dennoch die Wortstellung nicht so streng geregelt haben wie das Französische"<br />
(Lerch 1934:269). Schließlich wendet Lerch gegen Le Coultres These ein, dass im<br />
Neufranzösischen gerade in den Fällen, in denen noch eine morphologische Kasusunterscheidung<br />
existiert, nämlich bei den Pronomina, die Inversion relativ selten, während sie<br />
beim Substantiv verhältnismäßig häufig ist.<br />
Diese Einwände sprechen klar gegen den behaupteten Zusammenhang zwischen Wortstellung<br />
und der morphologischen Kasusmarkierung im Altfranzösischen und dessen Entwicklung<br />
zum Neufranzösischen. Anders verhält es sich möglicherweise mit der Annahme,<br />
dass die altfranzösische Wortstellung durch syntaktische Faktoren geregelt ist. Dies ist, wie<br />
bereits gezeigt, die Auffassung von Thurneysen (1892:304), dessen Analyse zufolge aus<br />
einer rein rhythmischen Anordnung der Satzglieder im Altfranzösischen per Analogiebildung<br />
bereits "in frühromanischer Zeit ein syntaktisches Prinzip" geworden war.<br />
Wie bereits erwähnt, findet Thurneysens Arbeit und damit dessen Annahme einer syntaktisch<br />
bedingten Wortstellung im Altfranzösischen in der traditionellen Romanistik nur<br />
wenig Beachtung. Für die generative historische Syntax des Französischen stellt sie aller-