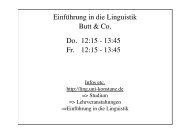Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Untitled - Fachbereich Sprachwissenschaft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
sie nach Meyer-Lübke (1899:797) durch eine zweite Regel "gekreuzt [wird], wonach in der<br />
Aussage unter allen Umständen das Subjekt dem Verbum voranzugehen hat".<br />
In Richters Untersuchung geht es weniger um die Entwicklung innerhalb der romanischen<br />
Sprachen als primär – wie der Titel sagt – um die Entwicklung der Wortstellung der<br />
romanischen Sprachen aus dem Lateinischen. Richter (1903:1) weist zunächst darauf hin,<br />
dass bei einem Vergleich der romanischen Wortstellung mit der des klassischen Lateins<br />
"als Hauptunterschied ihre grössere Einfachheit, ihre übersichtlichere Anordnung der<br />
logisch zusammengehörigen Teile" auffällt. Ihre zentrale Beobachtung und These, die sie<br />
an Hand umfangreichen Beispielmaterials belegt, ist allerdings die, dass bereits innerhalb<br />
des frühesten Lateins die 'einfachere' romanische Wortstellung existierte:<br />
Gehen wir aber den Belegen für R[omanische] W[ortstellung] in ihrer ganzen Ausdehnung nach,<br />
so zeigt es sich, dass sie sich nicht erst in Texten findet, die in romanischer Zeit geschrieben, bereits<br />
den Wiederschein des Romanischen geben, auch nicht erst in solchen, die das Lateinische im<br />
Stadium der Auflösung zeigen, sondern in Texten, die ein lautlich und formell tadelloses Latein<br />
aufweisen, und die daher geeignet sind, den Beweis zu geben, dass die R[omanische] W[ortstellung]<br />
sich tief aus der L[ateinischen] heraus entwickelt hat. (Richter 1903:3)<br />
Richter (1903:12) unterscheidet vier lateinische Wortstellungstypen, die sich "bis in die Gegenwart<br />
oder wenigstens bis an den Beginn der neusprachlichen Periode" erhalten haben:<br />
Adverb – Verb, Objekt – Verb, Prädikat – Verb und Verbum infinitum – Verbum finitum.<br />
Die in den romanischen Sprachen zu beobachtende Inversion von Subjekt und Verb, auf die<br />
Richter (1903:134-157) in einem gesonderten Kapitel eingeht, kann nach Richter<br />
(1903:150) nicht auf das Lateinische zurückgeführt werden, da dort "das Verb immer am<br />
Ende steht, die anderen Glieder mögen beliebig geordnet sein, je nach der Betonung, die sie<br />
haben sollen". Erst die allmähliche Verschiebung der Position des Verbs von der Endstellung<br />
zur Satzmitte hin, die nach Ansicht von Richter (1903:45) auf einem "inneren –<br />
psychologischen – Gesetz" beruht, und die damit verbundene "Auffassung Subjekt-<br />
Verb-Übriges, ermöglicht eine Inversion im romanischen Sinne, und sie erklärt sich wohl<br />
am einfachsten aus der Umkehrung des ganzen Satzes [...]" (Richter 1903:150):<br />
[...] wenn eines der Satzglieder von seinem gewöhnlichen Platze genommen wird, so ist die Reihenfolge<br />
der übrigen auch gestört; die erste Verschiebung zieht noch andere nach sich: Wird das<br />
Subjekt aus irgend einem rhetorischen oder psychologischen Grunde von der ersten Satzstelle gerückt,<br />
so kann es nicht mehr vor dem Verb stehen, wenn das nun den Satz eröffnende Wort – Adverb,<br />
Objekt oder Prädikat – mit dem Verb begrifflich zu eng verbunden ist, als dass es vom Verb<br />
getrennt werden könnte. Folglich rückt das Subjekt in so einem Falle an die Stelle nach dem<br />
Verb. (Richter 1903:140)<br />
Die meisten anderen traditionellen romanistischen Wortstellungsuntersuchungen widmen<br />
sich ausschließlich einer Einzelsprache, und zwar vorwiegend dem Französischen. Allenfalls<br />
werden Vergleiche zwischen zwei romanischen Sprachen angestellt (Crabb 1955).<br />
Auch in der modernen, generativen Sprachwandelforschung wird die Wortstellung romanischer<br />
Sprachen vorwiegend unter einzelsprachlichen Aspekten untersucht, wobei auch hier<br />
die Untersuchung des Französischen deutlich im Vordergrund steht. Eine Ausnahme bilden<br />
vor allem die Arbeiten aus der Schule um Lorenzo Renzi, in denen das Italienische und<br />
auch das Gesamtromanische im Mittelpunkt stehen (cf. Vanelli / Renzi / Benincà 1985,<br />
Benincà 1994 oder Salvi 1993, 2001).<br />
57