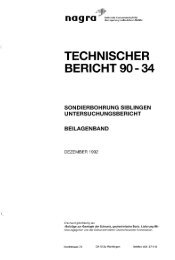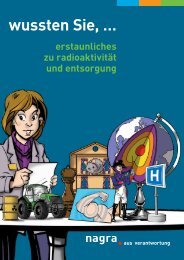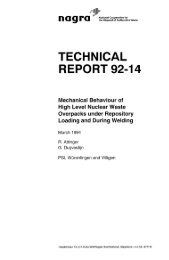Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-75 -<br />
- in den vorwiegend karbonatischen Sedimenten<br />
des Mesosoikums die W ãrmeleitfãhigkeit mit<br />
dem Kalkgeha1t zunimmt.<br />
5.4.9 Felsmechanische Untersuchungen<br />
Felsmechanische Untersuchungsresu1tate aus der<br />
Bohrung Weiach liegen bis anhin keine vor. Ein hierfür<br />
den Effinger Schichten zwischen 457.09 und<br />
457.69 m entnommenes Mergelka1k-Kemsruck zerfiel<br />
beim Ausbohren der Prüfkõrper in unbrauchbare<br />
Bruchstücklein. Bei Bedarf kõnnen die entsprechenden<br />
Parameter jedoch jederzeit aus den petrophysika1ischen<br />
Logs berechnet werden.<br />
5.5 KOHLENPETROGRAPHIE UND<br />
-CHEMIE<br />
5.5.1 Inkohlungsprofil<br />
Der Inkohlungsgrad kann mit Hilfe mikroskopischer<br />
Ret1exionsmessungen an Vitriniten, den aus humosen<br />
Substanzen hervorgegangenen organischen<br />
Bestandteilen im Sediment, ermitte1t werden. Beim<br />
Fehlen vitrinitischer Einlagerungen bedient man sich<br />
zusãtz1ich der Fluoreszenzmikroskopie und misst die<br />
Spektren der durch die Bestrahlung mit kurzwe1ligem<br />
Licht zur F1uoreszenz angeregten Liptinite (fossi1e<br />
A1gen, Sporen, Pollen etc.)<br />
Mit steigender Inkohlung nimmt der Reflexionsgrad<br />
des Vitrinits zu. Bei den verschiedenen Liptiniten<br />
verschieben sich die Fluoreszenzfarben von grün<br />
nach rot, unter gleichzeitiger Abnahme der Intensi,.<br />
tãt.<br />
In der Bohrung Weiach wurde die Inkohlung fast<br />
ausschliesslich mit Ret1exionsdaten bestimmt, wobei<br />
stets die maxima1e Reflexion (R xnax) des Vitrinits<br />
gemessen wurde. Messbare organische Partikel setzten<br />
ab einer Tiefe von 365 m, d.h. im oberen Oxfordien,<br />
ein.<br />
Das Inkohlungsproftl (Beil. 5.11) zeigt bis ca. 1'400m<br />
eine langsame, dann eine schnellere Zunahme der<br />
Reflexionswerte mit der Tiefe. Leider fehlen zwischen<br />
965 m und 1'300 m organische Bestandteile, so<br />
dass sich nicht sagen lãsst, ob ein al1mãhlicher oder<br />
diskontinuierlicher Übergang zwischen den beiden<br />
Entwicklungslinien vorliegt.<br />
5.5.2 Fossile Maturitãt, Palãothermogradienten<br />
Der Reifegrad (Maturitãt) des organischen Materia1s<br />
wird einerseits durch die Temperaturverhãltnisse<br />
vor Ort, andererseits aber auch durch die Dauer der<br />
Erwãrmung bestimmt. Nach dem Ansatz von LOP A<br />
TIN/W APLES ist es mõg1ich, die Maturitãtsentwicklung<br />
rein rechnerisch zu bestimmen (W APLES,<br />
1980). Durch entsprechende Zeit -Temperatur-Vorgaben<br />
wird eine bestmõg1iche Übereinstimmung mit<br />
den tatsãchlich gemessenen Werten angestrebt, um<br />
so zu verlãsslichen Angaben bezüg1ich der Temperaturgeschichte<br />
zu gelangen. In Bei1age 5.11 sind die<br />
Ergebnisse zweier solcher Modellrechnungen dargestellt.<br />
Für das Modell A wurde von einer Obert1ãchentemperatur<br />
von 8°C und einem geothermischen Gradienten<br />
von 48°C/km ausgegangen. Hebungs- und Versenkungsphasen<br />
blieben unberücksichtigt. Dies entspricht<br />
in etwa den heutigen, im Bohrloch ermittelten<br />
Werten, die einen GH:RT-Gradienten von ca.<br />
46°C/km ergaben.<br />
Das Modell B dagegen geht von einer durchschnittlichen<br />
Oberflãchentemperatur von 20°C aus. Dadurch<br />
verschiebt sich, bei gleichbleibendem Thermogradienten,<br />
die Trendlinie so, dass innerha1b des Mesozoikums<br />
eine annehmbare Übereinstimmung erzielt<br />
wird. Für das Permokarbon musste dann aber ein<br />
bedeutend hõherer Temperaturgradient von<br />
104°C/km eingeführt werden, um eine akzeptable<br />
Übereinstimmung mit den beobachteten Ret1exionswerten<br />
zu erreichen. Gleichzeitig wurden bei diesem<br />
Modell auch die aus dem 1ithologischen Profil<br />
abschãtzbaren Hebungs- und Senkungsbetrãge (vgl.<br />
KEMTER, 1987: Fig. 2) mitberücksichtigt.<br />
Aus den erwãhnten Berechnungen und der Gegenüberstellung<br />
der beiden in Bei1age 5.11 dargestellten<br />
Modelle A und B ergeben sich folgende Schlüsse:<br />
- Mit der heutigen Temperaturverteilung, die<br />
ungefãhr dem Modell A entspricht, lãsst sich der<br />
Tiefenverlauf der gemessenen organischen Reife<br />
nicht erklãren. Auch unter Annahme einer weit<br />
hõheren Oberflãchentemperatur (20°C) klaffen<br />
im Permokarbon-Intervall die berechneten und<br />
die beobachteten Werte mit zunehmender Tiefe<br />
immer weiter auseinander. Wãhrend der Permokarbonzeit<br />
muss daher ein wesentlich hõherer<br />
Thermogradient geherrscht haben, um die ab<br />
1'400 m beobachtete raschere Maturitãtszunabme<br />
mit der Teufe zu erklãren. Zum gleichen Ergebnis<br />
führen auch die Untersuchungen der F1üssigkeitseinschlüsse<br />
in Quarzen (Kap. 6.6.5).