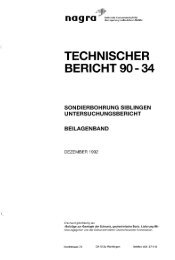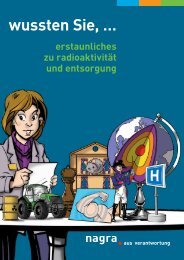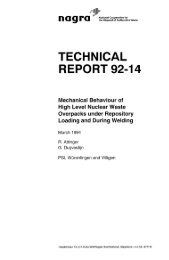Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
- 22-<br />
5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER SEDIMENTE<br />
5.1 METHODIK DER BOHRKERN<br />
BESCHREIBUNG<br />
5.1.1 Arbeiten auf der Bobrstelle<br />
Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro durch die<br />
Bohrstellen-Geologen geologisch-petrographisch<br />
beschrieben und in .einem provisorischen lithologischen<br />
Profil im Massstab 1:50 und 1:1000 dargestellt.<br />
Die Beschreibung beruht auf einer ãusseren Betrachtung<br />
der Kerne. Das Log diente sowohl für die<br />
Planung und erste Auswertung von hydrogeologischen<br />
und geophysikalischen Tests wie auch als erste<br />
Orientierung der für die weitere Bearbeitung zustãndigen<br />
Forschungsinstitute.<br />
In den Sedimenten erfolgte die Strukturaufnahme<br />
(Klüftung, Schichtung) direkt an den mittels der<br />
Multishot-Methode orientierten Bohrkernen.<br />
Nach der Kernaufnahme wurden Gesteinsbeschreibungen<br />
und Strukturdaten im Baustellenbüro<br />
codiert und auf die Computererfassungsblãtter der<br />
<strong>Nagra</strong>-Datenbank NAGRADATA übertragen. Die<br />
Sedimentbohrkerne wurden anschliessend fotografiert,<br />
in Plastikschlãuche vakuumverpackt und zur<br />
weiteren Bearbeitung an das Geologische Institut<br />
der Universitãt Bern transportiert. Für felsmechanische<br />
Versuchszwecke (ETH Zürich) mussten reprãsentative<br />
Kernstücke eingewachst werden, um ein<br />
Austrocknen der Bergfeuchte zu verhindern.<br />
Auf der Bohrstelle war wãhrend der Bohrphase ein<br />
Sampler-Dienst im Einsatz, welcher das Sampler<br />
Log 1:200 erstellte. Neben lithologischen Angaben<br />
der Bohrstellen-Geologen enthãlt es die wichtigsten<br />
bohrtechnischen Daten sowie die kontinuierlich registrierten<br />
Gasgehalte der Bohrspülung.<br />
5.1.2 Laboruntersucbungen<br />
Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut der<br />
Universitãt Bern überführten Kerne wurden der<br />
Lãnge nach entzweigesãgt. Die Archivhãlften wurden<br />
sofort in Plastik vakuumverpackt und ins Kernlager<br />
der N agra zurückgeschoben. Die Arbeitshãlften<br />
wurden mit einer SINAR -Plattenkamera fotografiert;<br />
anschliessend erfolgten die lithologische Detai1aufnahme<br />
und die Probennahme für sãmt1iche im Arbeitsprogramm<br />
Weiach (NTB 82-10) aufgeführten<br />
Laboruntersuchungen. Dann wurden auch die Arbeitshãlften<br />
vakuumverpackt und nach Abschluss der<br />
Analysen ebenfalls ins Kern1ager der N agra transportiert.<br />
5.2 STRATIGRAPHIE UND<br />
SEDIMENTOLOGIE<br />
5.2~1 Profilbescbreibung und Nomenklatur<br />
Basierend auf der Hthologischen Detai1aufnahme<br />
und den Laboruntersuchungen wurden Proftle im<br />
Massstab 1:200 und 1:1000 erstellt. Auf dem Übersichtsprofil<br />
1:1000 (Beil. 5.1a-e) wurden zudem die<br />
mineralogische Zusammensetzung und die relativen<br />
Tonmineralgehalte sowie einige wichtige geochemische<br />
und petrophysikalische Parameter dargestellt.<br />
Das Detailprofi1 1:200 ist in MA TTER et al.<br />
(NTB 86-01) als Bei1age enthalten.<br />
Aufgrund des lithostratigraphischen Proills, dessen<br />
Vergleich mit der Schichtfolge benachbarter Gebiete<br />
sowie der gefundenen Ammoniten konnten die mesozoischen<br />
Sedimente gut gegliedert und relativ<br />
eindeutig den bekannten stratigraphischen Einheiten<br />
zugeordnet werden. Für die Permokarbon-Sedimente<br />
erwies sich eine sedimentologisch-genetische<br />
Unterteilung als zweckmãssig und sinnvoll, zumal<br />
weder die palãontologischen Funde eine Feingliederung<br />
erlauben, noch auf altbekannte Formationsnamen<br />
zurückgegriffen werden konnte.<br />
Die Mãchtigkeiten und Teufen der in der Sondierbohrung<br />
Weiach erbohrten stratigraphischen Einheiten<br />
sind in den Beilagen 5.1a-e aufgeführt. Die<br />
Gesteinsansprache erfolgte nach dem Grunddiagramm<br />
von FÜCHTBAUER (1959), nach FOLK<br />
(1962) und DUNHAM (1962). Die Klassifizierung<br />
der Anhydritgesteine wurde nach MAIKLEM et al.<br />
(1969) vorgenommen. Die wichtigsten Anhydritstrukturen<br />
sind im Geologiebericht Bõttstein<br />
(NTB 85-02, Beil. 6.5) abgebi1det. Die im Profil