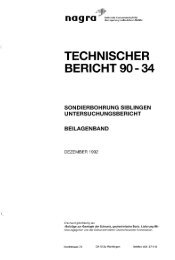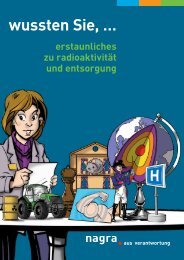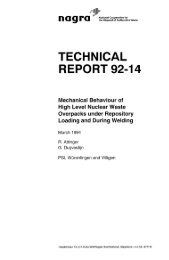Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
-112-<br />
Der Aplitgranit liegt mit seinen Th- und U-Gehalten<br />
durchaus im Rahmen der granitischen Gesteine, hingegen<br />
sind die Laborwerte für den Aplit bei 2'215 m<br />
extrem gering und kaum für alle Aplite reprãsentativ.<br />
Dies zeigen auch die am selben Gang ermittelten,<br />
deutlich hõheren Log-Messwerte. Die Übereinstimmung<br />
der Labor- und Bohrlochmessungen<br />
(Beil. 6.17) ist beim Th mãssig, etwas besser beim U<br />
und gut beim K. Bei der Beurteilung muss jedoch<br />
mitberücksichtigt werden, dass die Bohrkern- und<br />
die Log-Metrierung nicht immer ganz genau übereinstimmen.<br />
Zudem wird mit dem Log ein anderer<br />
Gesteinsteil erfasst als mit der Labormessung, d.h.<br />
im einen Fall wird in der Bohrlochumgebung, im<br />
andern Fall am Bohrkern selbst gemessen. Die<br />
Bereiche, innerhalb derer die Gehalte im Log oszillieren,<br />
passen jedoch zu den gemessenen, mittleren<br />
Laborwerten. Das Log zeigt als. Regel eine positive<br />
U-Th-Korrelation. Doch kõnnen auch starke Th<br />
Erhõhungen oder Erniedrigungen ohne Effekt beim<br />
U-Gehalt oder gegenlãufige Peaks auftreten. Dabei<br />
fãllt auf, dass in der unmittelbaren Umgebung von<br />
aberranten Th-Peaks hãufig ''Typ 1"-umgewandelte<br />
Gneise vorkommen. Trotz der vor allem in Bereichen<br />
verstãrkter Kataklase stark schwankenden Thund<br />
U-Werte kommen die grõsseren Aplitgãnge mit<br />
ihren tiefen Gehalten im Log recht deutlich zum<br />
Ausdruck.<br />
6.7.3 Kationenaustausch<br />
Vorstellungen über die Kationenaustausch-Kapazitãt<br />
der Gesteine sind zur Beurteilung von Fluid!Gesteins-Interaktionen<br />
von Bedeutung. Zudem gibt die<br />
Art der ausgetauschten Kationen Hinweise auf die<br />
Zusammensetzung der jüngsten Formationswãsser,<br />
die mit den Schichtsilikaten Kationen austauschten.<br />
Die Bestimmungen wurden mit BaC12-Lõsung<br />
durchgeführt. Nãheres zur Methodik findet sich in<br />
MATTER et al. (NTB 86-01). Es wurden ausschliesslich<br />
stark tektonohydrothermal beeinflusste<br />
Gneise untersucht. Die Resultate sind auf Beilage<br />
6.18 zusammengestellt.<br />
Die Gesamtaustauschkapazitãten sind mit 10-<br />
14 mvaVl00g recht hoch, liegen sie doch im gleichen<br />
Bereich wie diejenigen der überliegenden Tone des<br />
Stephanien und des vertonten Bõttstein-Granites.<br />
Dies widerspiegelt den hohen Schichtsilikatanteil der<br />
Proben (um 60 Vol.-%), wobei chlotitisierter Biotit,<br />
Chlorit und Sericit/lllit die wichtigsten austauschenden<br />
Mineralien bilden. Die Probe 2'272.07 m weist<br />
eine geringere Austausch-Kapazitãt auf, weil dort<br />
der Anteil an feinkõrnigen Schichtsilikaten geringer<br />
ist. Der hohe Wert der ebenfalls Schichtsilikat-armen<br />
Probe 2'095.50 m kõnnte auf den Apophyllit zurückgehen,<br />
der ãhnliche Austauschkapazitãten wie Zeolithe<br />
aufweist, aber auch leicht Ca 2 -+- -Ionen aus dem<br />
Gitter abgeben kõnnte.<br />
U nter den ausgetauschten Kationen dominiert<br />
Ca 2 -+- mit 55-60% Anteil. Die Probe 2'095.50 m mit<br />
Apophyllit weist gar 71% auf. Gesamthaft ist die<br />
Kationenbelegung ziemlich homogen (Beil. 6.18)<br />
und gleicht derjenigen des Kristallins von Bõttstein,<br />
Leuggern und z.T. auch von Kaisten. Dies ist erstaunlich,<br />
da in diesen Bohrungen das permische,<br />
tektonohydrothermale Ereignis mit seiner Vertonung<br />
stark ausgeprãgt ist, wãhrend im Weiacher Kristallin<br />
eine Zerbrechung und eine Durchdringung mit (permischem?)<br />
CaCb-reichem Fluid nur gerade an den<br />
Flüssigkeitseinschlüssen sichtbar wird. Der Austausch<br />
zwischen Fluid und Schichtsilikaten und die<br />
neue, Ca 2 -+- - dominante Belegung der austauschbaren<br />
Kationenplãtze wãre demnach ohne begleitende<br />
Vertonung erfolgt. Allerdings würde man dann in<br />
den hangenden Karbonsedimenten eine analoge<br />
Kationenbelegung erwarten. Dies ist aber nicht der<br />
Fall, vielmehr findet man dort Na -+- plõtz1ich mit<br />
41% vertreten (Kap. 5.6.4). Mõglicherweise ist dies<br />
aber die Folge einer noch jüngeren Fluiddurchdringung<br />
der Sedimente, die nicht in das Kristallin<br />
einzudringen vermochte. Mit der Zusammensetzung<br />
der heutigen Formationswãsser, die extrem Na -+- -betont<br />
sind, scheint die Kationenbelegung des Kristallins<br />
und der Stephanien-Sedimente nichts zu tun zu<br />
haben (Beil. 6.18).<br />
6.7.4 Isotopenuntersuchungen<br />
Zusammen mit den Isotopenanalysen an Grundwasserproben<br />
wurden auch einige Isotopenuntersuchungen<br />
an Mineralen durchgeführt. Probenauswahl und<br />
Analysen erfolgten im Rahmen des <strong>Nagra</strong>-Untersuchungsprogrammes<br />
"Hydrochemie Nordschweiz"<br />
und sind, wie auch die Methodik, in NTB 88-07 ausführlich<br />
diskutiert.<br />
6.7.4.1 SauerstotT- und Strontiumisotopen<br />
Aus dem Kristallin von Weiach wurden Calcite<br />
untersucht (Beil. 6.20), die geschlossenen Klüften<br />
mit derber Calcitfü1lung entnommen wurden. Vom<br />
geologisch-petrographischen Gesichtspunkt aus<br />
betrachtet, handelt es sich dabei um identische Bildungen.<br />
Ausgehend von den Isotopengehalten und<br />
den Temperaturen der heutigen Formationswãsser<br />
kann der theoretische 8 18 0-Wert (= Abweichung in<br />
%0 von den Werten des Standard Mean Ocean