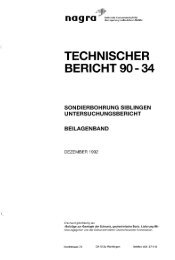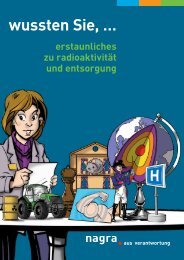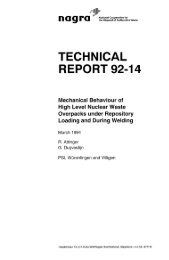Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-109 -<br />
nur in Kluftcalciten des Ma1ms und in Calcitzementen<br />
des Tertiãrs angetroffen.<br />
Die Temperaturen des ersten Schmelzens (Solidus)<br />
liegen genere11 zwischen -75°C und -39°C. Dies passt<br />
zu den Systemen H20-CaCb, H20-NaCI-CaCb und<br />
H20-NaCI-CaCb-MgCb, deren eutektische Temperatur<br />
bei -49.8°C, -52°C bzw. -57°C liegt.<br />
Die Schmelzpunkte T L (Liquidus) der früheren, salzreichen<br />
Einschlüsse dieser Gruppe liegen zwischen<br />
-17° und -22°C, diejenigen der spãteren, salzãrmeren<br />
zwischen _13° und l°C. Die entsprechenden Salzgehalte<br />
betragen mehr als 20 rsp. 2-17 Ãquivalentgew.-%<br />
NaCl.<br />
Die Homogenisationstemperaturen T H varüeren von<br />
20-30°C im Buntsandstein und Oberrotliegenden bis<br />
95-105°C im Stephanien. Im Kristallin wurden Werte<br />
zwischen 83 und 111°C gemessen. Nach MULLIS<br />
(1987) kõnnen, infolge geringer Methanbeimengungen,<br />
die Einschlusstemperaturen 10-20°C über den<br />
Homogenisationstemperaturen gelegen haben. Das<br />
erstmalige Auftreten der extrem salzreichen Fluids<br />
dürfte mit dem Wechsel von feuchthumiden zu semiariden<br />
Bedingungen im Rotliegenden zusammenhãngen.<br />
Unter den semiariden Bedingungen entwickelten<br />
sich durch Evaporation hochsaline Grundwãsser<br />
(vg1. Kap. 9.7.4).<br />
Eventue11 bewirkte schon das permische tektonohydrothermale<br />
Ereignis (PETERS, 1987; MEYER,<br />
1987; KEMPTER, 1987) ein erstmaliges Eindringen<br />
der salzreichen Grundwãsser in tiefere Bereiche der<br />
liegenden Sedimente und ins Kristallin. Die z.T. primãren<br />
Einschlüsse in den authigenen Quarzen aus<br />
dem Oberrotliegenden (1'120.30 m) und dem Buntsandstein<br />
(981.84 m) bestãtigen mit ihren niedrigen<br />
Homogenisationstemperaturen von 30°C, dass kurze<br />
Zeit nach der Sedimentation die Porenwãsser immer<br />
noch eine extrem hohe Salinitãt aufwiesen.<br />
Über den Entstehungs- und Einschliessungsprozess<br />
der ebenfalls CaCb-haltigen, jedoch wesentlich salzãrmeren<br />
Fluids der Ma1m- und Molasseproben ist<br />
noch wenig bekannt. Allgemein gilt jedoch, dass die<br />
heutigen Grundwãsser eine geringere Salinitãt besitzen<br />
als die Fluids der Flüssigkeitseinschlüsse. Die<br />
Frage, ob eine kontinuierliche Ãnderung der CaC12-<br />
haltigen Fluids seit dem Perm stattfand oder nicht,<br />
kann aufgrund der wenigen Messwerte nicht beantwortet<br />
werden, da auch eine separate Entwicklung<br />
innerhalb der heute als selbstãndige Formationswassersysteme<br />
vorliegenden Aquifere des Malms, des<br />
Muschelkalkes und des Kristallins denkbar ist. Auch<br />
sprunghafte Ãnderungen, z.B. durch tektonisch bedingte<br />
Klüftung, kõnnen nicht ausgeschlossen werden.<br />
6.6.6 Die tektonohydrothermalen Beeinflussungen<br />
im regionalgeologischen Gesamtrahmen<br />
Im Vergleich zum Südschwarzwald ist das Kristallin<br />
von Weiach ausserordentlich stark tektonohydrothermal<br />
überprãgt. Sowohl die Deformationsstrukturen<br />
als auch die Einschlussuntersuchungen deuten<br />
auf ein Prã-Stephanien-Alter der Kataklase und der<br />
beg1eitenden hydrothermalen "Typ 2"-Umwandlung<br />
hin. Aufgrund der Altersbestimmung an Biotiten<br />
(Kap. 6.7.5) muss ein oberkarbonisches Alter von<br />
rund 300-320 Mio.J. angenommen werden.<br />
Die ãltere "Typ l"-UmwandIung ist durchaus verg1eichbar<br />
mit den allerdings wesentlich intensiveren<br />
pegmatitisch-pneumatolytischen Prozessen, die im<br />
Bõttstein- und Leuggern-Granit und in den Metapeliten<br />
von Kaisten und Leuggern abliefen. Sie kõnnte<br />
daher ebenfalls durch migmatische bzw. magmatische<br />
Restfluids ausgelõst worden sein und hãtte<br />
dann kaledonisches Alter.<br />
Das Nebeneinander von kataklastischen Stõrungszonen<br />
ohne oder mit gerichtetem Gefüge, die z.T. "vernetzten"<br />
Strukturen und chaotischen Texturen und<br />
die lokal offensichtlich hohe Mobilitãt der kataklastischen<br />
Matrix deuten auf Prozesse hin, die durch eine<br />
Kombination von tektonischen Bewegungen und hohen<br />
Porent1uiddrucken gekennzeichnet waren. Dies<br />
ist nicht weiter erstaun1ich, wird doch im Oberkarbon<br />
eine regionaIe, dextral-konvergente (Von GEH<br />
LEN et al., 1986) respektive dextral-transpresssive<br />
(LAUBSCHER, 1986) Tektonik mit begleitender<br />
Granitintrusionstãtigkeit postuliert. Das durch die<br />
hydrothermalen Umwandlungen und die Einschlüsse<br />
belegte Fluid kõnnte durch konvektive Zirkulation<br />
um einen in der nãheren Umgebung intrudierten<br />
Pluton erklãrt werden. Aufgrund der vorliegenden<br />
hydrothermalen Paragenese Chlorit -Prehnit -Pumpellyit-Albit<br />
kann eine maximale Temperatur von rund<br />
400°C (vgl. NTB 86-01: Kap. 7.4.3) angenommen<br />
werden, was für die Fluideinschlüsse einen Maximaldruck<br />
von etwa 1 Kilobar ergibt. Der daraus resultierende<br />
hohe geothermische Gradient fügt sich gut in<br />
das BiId ein. Zudem wurde auch aus der fossiIen<br />
Maturitãt des organischen Materials der permokarbonen<br />
Sedimente auf einen erhõhten geothermischen<br />
Palãogradienten geschlossen, der bis ans Ende des<br />
Unterperms geherrscht haben sol1 (Kap. 5.1). Wahrscheinlich<br />
ist dies nichts anderes als das Andauern<br />
des durch die oberkarbonische magmatische Aktivitãt<br />
erzeugten hohen Gradienten. Die zumindest in<br />
bezug auf die Temperatur retrograde Entwicklung<br />
der NaCI-Fluids im Kristallin kann einerseits durch<br />
anhaltende tektonohydrothermale Aktivitãt und