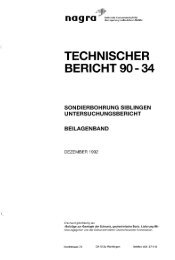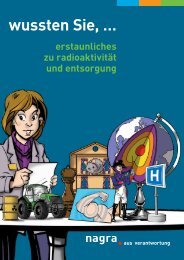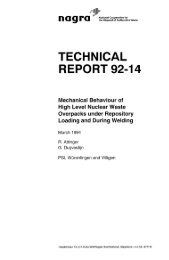Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-180 D<br />
mit Fallwinkeln von 38° bis 62° gegen Westen (Fallazimute<br />
von 247° bis 291°) ein. Die Klüfte bilden ein<br />
zusammenhãngendes Kluftsystem, in dem die Wasserführung<br />
hauptsãchlich stattfmdet. Die wasserführende<br />
Zone (2'066 m) hat somit eine scheinbare<br />
Mãchtigkeit von etwa 4 m und liegt zwischen 2'063<br />
und 2'067 m Teufe.<br />
2'221 m<br />
Zwischen 2'215.20 m und 2'218.94 m Teufe tritt im<br />
Bohrproftl ein etwa 45° steiler, geklüfteter Biotit<br />
Aplitgang auf (Beil. 10.2). An den Bohrkernen wurden<br />
keine eindeutig offenen Klüfte im Aplit festgestel1t.<br />
Die existierenden Klüfte sind in der Regel<br />
nicht aufgebrochen. Sie weisen keine oder nur sehr<br />
dünne Kluftfüllungen (Chlorit, Calcit und Quarz,<br />
Kluftdicken S 1 mm) auf. Zwischen 2'215.9 und<br />
2'216.26 m ist am Bohrkern eine aufgebrochene, vollstãndig<br />
gefüllte Quarz-Chlorit-Kluft (Kluftdicke<br />
S 4 mm) sichtbar.<br />
Unter dem Aplit folgt ein mittelkõrniger Biotit<br />
Plagioklas-Gneis. Bei den Bohrkernaufnahmen wurden<br />
keine eindeutig offenen Klüfte gefunden. Relativ<br />
steil stehende (40°-65°), vollstãndig gefüllte Quarz<br />
Klüfte (Kluftdicken bis zu 1 mm) treten vor allem<br />
zwischen 2'221 und 2'222 m Teufe auf. Des weiteren<br />
gibt es bei 2'223.3 m Teufe zwei steilstehende und<br />
etwa 50 cm lange Calcit-Klüfte (Kluftdicke etwa<br />
1 mm). Die Klüfte scheinen vollstãndig verheilt zu<br />
sein.<br />
Aufgrund der Bohrkernaufnahmen gibt es also keine<br />
eindeutig offenen Klüfte, denen sich der in den<br />
Fluid-Logs erkennbare Zufluss bei etwa 2'221 m<br />
Teufe zuordnen liesse. Zu beachten ist allerdings,<br />
dass zwischen 2'216.6 und 2'217.3 m kein Bohrkern<br />
vorhanden ist (Kernverlust). Ausserdem sind die<br />
Kerne unterhalb von 2'220.7 m stark zerbrochen. Die<br />
Existenz von offenen Klüften im fraglichen Tiefenbereich<br />
kann daher auch nicht ausgeschlossen werden.<br />
Nach dem Abteufen des Kernmarsches 2B7 (2'215.4-<br />
2'217.3 m) wurde ein eindeutig erhõhter artesischer<br />
Ausfluss aus dem Bohrloch gemessen (Flow-Check,<br />
MATTER et al., NTB 86-01: Beil. 7.41). Demzufolge<br />
muss der entsprechende Bohrlochabschnitt eine erhõhte<br />
hydrau1ische Durchlãssigkeit aufweisen. Aufgrund<br />
der F1uid-Logs (und des SP-Logs) liegt das<br />
Maximum des Zuflusses jedoch bei etwa 2'221 m.<br />
Diese Diskrepanz ist zu gross, als dass sie auf messtechnische<br />
Fehler allein zurückgeführt werden<br />
kõnnte.<br />
Es gibt zwei Mõglichkeiten, die auf den ersten Blick<br />
widerspüchlichen Daten zu erklãren:<br />
1. Es gibt zwei getrennte Systeme von offenen Klüften,<br />
eines bei etwa 2'216.5 m und ein zweites bei<br />
2'221 m. Das erste wãre als ein re1ativ durchlãssiges,<br />
aber begrenztes Kluftsystem im Aplitgang zu<br />
charakterisieren. Damit wãre der kurzzeitig erhõhte<br />
Ausfluss direkt nach dem Durchteufen verstãndlich.<br />
Des weiteren würde es sich mõglicherweise<br />
noch im ersten Fluid-Log vom 13.11.1983<br />
bemerkbar machen. Das würde erklãren, warum<br />
die Anoma1ie im AMS-Log vom November 1983<br />
wesentlich breiter als bei den spãter aufgenommenen<br />
Logs ist (Beil. 8.12).<br />
Das zweite Kluftsystem bei 2'221 m Teufe wãre<br />
ein weniger durchlãssiges, aber vergleichsweise<br />
unbegrenztes System im Gneis. Der Zufluss wãre<br />
in diesem Fall nicht gross genug gewesen, um<br />
beim Flow-Check registriert zu werden. Andererseits<br />
kõnnte er in F1uid-Logs nach einer ausreichend<br />
langen Zuflusszeit sichtbar werden.<br />
2. Die zweite Mõglichkeit ist, dass im Aplit sowie in<br />
den obersten Metern des liegenden Gneis (2'215-<br />
2'222 m) ein zusammenhãngendes System von<br />
K1üften existiert. Das Kluftsystem wãre also mit<br />
dem bei 2'066 m vergleichbar.<br />
Nach dem Anbohren (Kernmarsch 2B7) würde<br />
ein derartiges Kluftsystem einen artesischen Ausfluss<br />
bewirken, wie er beim Flow-Check registriert<br />
wurde. Nach dem vollstãndigen Durchteufen<br />
fliesst das Formationswasser zum grõssten<br />
Teil aus tiefer liegenden, etwas durchlãssigeren<br />
K1üften des gleichen Kluftsystems in das Bohrloch.<br />
Die Minima in den Widerstandslogs würden<br />
damit etwas tiefer liegen.<br />
Aufgrund der vorliegenden Daten kann nicht entschieden<br />
werden, welcher der beiden Erklãrungsversuche<br />
der Rea1itãt besser entspricht.<br />
2'268 m<br />
Zwischen 2'261.6 und 2'269.87 m Teufe besteht das<br />
Gebirge aus einem Biotit-Plagioklas-Gneis (Beil.<br />
10.2). Verschiedentllch sind Aplitgãnge und Aplitschollen<br />
eingeschaltet. Der Fels ist streckenweise<br />
mãssig kataklastisch. Zwischen 2'269.87 und<br />
2'270.18 m Teufe tritt ein ca. 45° steiler Aplitgang<br />
auf. Im Liegenden folgt migmatischer Cordierit<br />
Biotit-Gneis mit Feldspat -Quarz-Leukosomen.