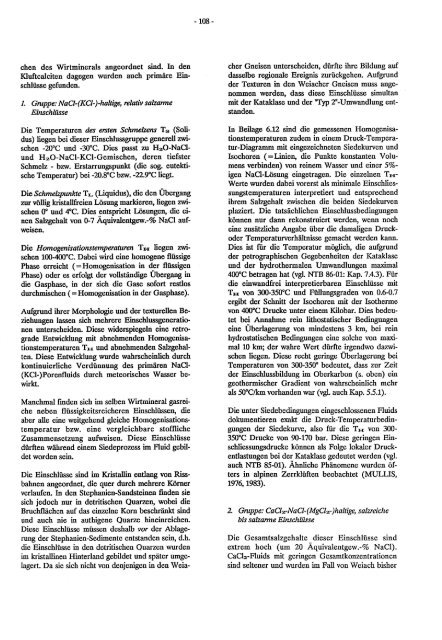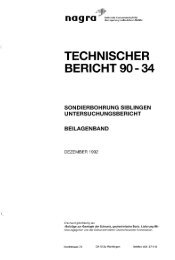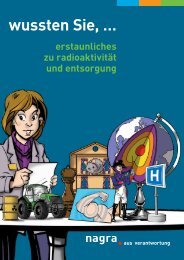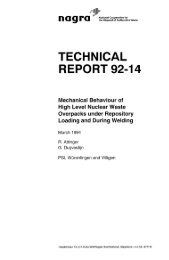Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-108 -<br />
chen des Wirtminerals angeordnet sind. In den<br />
Kluftcalciten dagegen wurden auch primãre Einschlüsse<br />
gefunden.<br />
1. Gruppe: NaCl-(KC1-)-haltige, relativ salzanne<br />
EinschlUsse<br />
Die Temperaturen des ersten Schmelzens T s (Solidus)<br />
liegen bei dieser Einschlussgruppe generell zwischen<br />
-20°C und -30°C. Dies passt zu H 2 0-NaClund<br />
H 2 0-NaCI-KCI-Gemischen, deren tiefster<br />
Schmelz - bzw. Erstarrungspunkt (die sog. eutektische<br />
Temperatur) bei -20.8°C bzw. -22.9°C liegt.<br />
DieSchmelzpunkte T L (Liquidus), die den Übergang<br />
zur võllig kristallfreien Lõsung markieren, liegen zwischen<br />
0° und 4°C. Dies entspricht Lõsungen, die einen<br />
Salzgehalt von 0-7 Ãquivalentgew.-% NaCl aufweisen.<br />
Die Homogenisationstemperaturen T H liegen zwischen<br />
100-4OQ°C. Dabei wird eine homogene t1üssige<br />
Phase erreicht (= Homogenisation in der t1üssigen<br />
Phase) oder es erfolgt der vollstãndige Übergang in<br />
die Gasphase, in der sich die Gase sofort restlos<br />
durchmischen ( = Homogenisation in der Gasphase).<br />
Aufgrund ihrer Morphologie und der texturellen Beziehungen<br />
lassen sich mehrere Einschlussgenerationen<br />
unterscheiden. Diese widerspiegeln eine retrograde<br />
Entwicklung mit abnehmenden Homogenisationstemperaturen<br />
T H und abnehmenden Salzgehalten.<br />
Diese Entwicklung wurde wahrscheinlich durch<br />
kontinuierliche Verdünnung des primãren NaCl<br />
(KCl-)Porent1uids durch meteorisches Wasser bewirkt.<br />
Manchmal fmden sich im selben Wirtmineral gasreiche<br />
neben flüssigkeitsreicheren Einschlüssen, die<br />
aber alle eine weitgehend gleiche Homogenisationstemperatur<br />
bzw. eine vergleichbare stoffliche<br />
Zusammensetzung aufweisen. Diese Einschlüsse<br />
dürften wãhrend einem Siedeprozess im Fluid gebildet<br />
worden sein.<br />
Die Einschlüsse sind im Kristallin entlang von Rissbahnen<br />
angeordnet, die quer durch mehrere Kõmer<br />
verlaufen. In den Stephanien-Sandsteinen fi.nden sie<br />
sich jedoch nur in detritischen Quarzen, wobei die<br />
Brucht1ãchen auf das einzelne Kom beschrãnkt sind<br />
und auch nie in authigene Quarze hineinreichen.<br />
Diese Einschlüsse müssen deshalb vor der Ablagerung<br />
der Stephanien-Sedimente entstanden sein, d.h.<br />
die Einschlüsse in den detritischen Quarzen wurden<br />
im kristallinen Hinterland gebildet und spãter umgelagert.<br />
Da sie sich nicht von denjenigen in den Weia-<br />
cher Gneisen unterscheiden, dürfte ihre Bildung auf<br />
dasselbe regionale Ereignis zurückgehen. Aufgrund<br />
der Texturen in den Weiacher Gneisen muss angenommen<br />
werden, dass diese Einschlüsse simultan<br />
mit der Kataklase und der "Typ 2"-Umwandlung entstanden.<br />
In Beilage 6.12 sind die gemessenen Homogenisationstemperaturen<br />
zudem in einem Druck-Temperatur-Diagramm<br />
mit eingezeichneten Siedekurven und<br />
Isochoren (=Linien, die Punkte konstanten Volumens<br />
verbinden) von reinem Wasser und einer 5%<br />
igen NaCI-Lõsung eingetragen. Die einzelnen Ta -<br />
Werte wurden dabei vorerst als minimale Einschliessungstemperaturen<br />
interpretiert und entsprechend<br />
ihrem Salzgehalt zwischen die beiden Siedekurven<br />
plaziert. Die tatsãchlichen Einschlussbedingungen<br />
kõnnen nur dann rekonstruiert werden, wenn noch<br />
eine zusãtzliche Angabe über die damaligen Druckoder<br />
Temperaturverhãltnisse gemacht werden kann.<br />
Dies ist für die Temperatur mõglich, die aufgrund<br />
der petrographischen Gegebenheiten der Kataklase<br />
und der hydrothermalen Umwandlungen maximal<br />
4OQ°C betragen hat (vgl. NTB 86-01: Kap. 7.4.3). Für<br />
die einwandfrei interpretierbaren Einschlüsse mit<br />
T H von 300-350°C und Füllungsgraden von 0.6-0.7<br />
ergibt der Schnitt der Isochoren mit der Isotherme<br />
von 4OO°C Drucke unter einem Kilobar. Dies bedeutet<br />
bei Annahme rein lithostatischer Bedingungen<br />
eine Überlagerung von mindestens 3 km, bei rein<br />
hydrostatischen Bedingungen eine solche von maximal<br />
10 km; der wahre Wert dürfte irgendwo dazwischen<br />
liegen. Diese recht geringe Überlagerung bei<br />
Temperaturen von 300-350° bedeutet, dass zur Zeit<br />
der Einschlussbildung im Oberkarbon (s. oben) ein<br />
geothermischer Gradient von wahrscheinlich mehr<br />
als 50°C/km vorhanden war (vgl. auch Kap. 5.5.1).<br />
Die unter Siedebedingungen eingeschlossenen Fluids<br />
dokumentieren exakt die Druck-Temperaturbedingungen<br />
der Siedekurve, also für die TH von 300-<br />
350°C Drucke von 90-170 bar. Diese geringen Einschliessungsdrucke<br />
kõnnen als Folge lokaler Druckentlastungen<br />
bei der Kataklase gedeutet werden (vgl.<br />
auch NTB 85-01). Ãhnliche Phãnomene wurden õfters<br />
in alpinen Zerrklüften beobachtet (MULLIS,<br />
1976, 1983).<br />
2. Gruppe: CaClrNaCl-(MgClr )haltige, salzreiche<br />
bis salzarme Einschlasse<br />
Die Gesamtsalzgehalte dieser Einschlüsse sind<br />
extrem hoch (um 20 Ãquivalentgew.-% NaCl).<br />
CaCb-Fluids mit geringen Gesamtkonzentrationen<br />
sind seltener und wurden im Fall von Weiach bisher