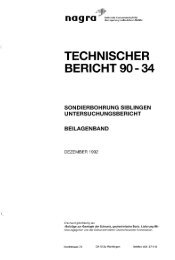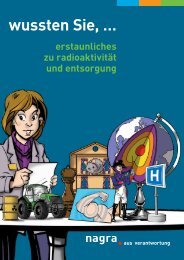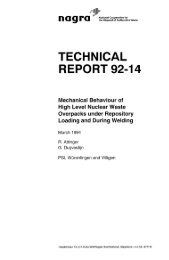Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
-162 -<br />
wirklich wasserfreie Trockenrückstãnde bei 180°C zu<br />
erhalten. Wie Beilage 9.5 zeigt, sind in diesen Fãllen<br />
die Glührückstãnde bedeutend geringer, was nicht<br />
nur auf einen Ver1ust von Krista1Iwasser und Koh1endioxid,<br />
sondem auch auf eine vo11stãndigere Trocknung<br />
zurückzuführen ist.<br />
9.5.2.3 Hydrochemische Modellrechnungen<br />
Die Verwendung von hydrochemischen Computermodellen<br />
bietet weitere Mõg1ichkeiten, die Konsistenz<br />
und die Qua1itãt von Laboranalysen zu testen.<br />
Mit entsprechenden Programmen kõnnen sowoh1 die<br />
innere Widerspruchsfreiheit einer Analyse als auch<br />
die Übereinstimmung und das Gleichgewicht einer<br />
Wasserprobe mit den Mineralen der entsprechenden<br />
Formation überprüft werden. Im FalI der Sondierbohrung<br />
Weiach wurde eine verbesserte Version<br />
von PHREEQE (PEARSON et al., NTB 86-19) verwendet.<br />
Das Programm war ursprüng1ich vom U.S.<br />
Geologica1 Survey für alIgemeine Gleichgewichtsberechnungen<br />
an Wãssern entwickelt worden (P ARK<br />
HURST et a1., 1980).<br />
Den Kern des Programms bi1det ein System von<br />
Gleichungen, das die verschiedenen Ionenaktivitãten<br />
und Gleichgewichtszustãnde in einer Lõsung beschreibt.<br />
Sind also die Konzentrationen der einzelnen<br />
Ionen bekannt, so kõnnen die Sãttigungsindices<br />
der Lõsung berechnet werden. Diese Sãttigungsindices<br />
beschreiben die jewei1s herrschenden Gleichgewichts-,<br />
Untersãttigungs- bzw. Übersãttigungszustãnde<br />
der modellierten Wãsser bezüg1ich bestimmter<br />
Minerale (z.B. Calcit, Dolomit oder Gips). Zusãtz1ich<br />
besteht die Mõg1ichkeit, chemische Reaktionen<br />
und Konzentrationsãnderungen zu simulieren,<br />
die auftreten, wenn Ionen oder Gase der Lõsung zugegeben<br />
oder aus ihr entfernt werden. Damit ist es<br />
beispie1sweise mõg1ich, das Entweichen von Koh1endioxid<br />
aus einer Probe wãhrend der Probennahme<br />
zu simulieren, oder den Ver1ust von Koh1endioxid in<br />
einer Ana1yse rechnerisch zu kompensieren.<br />
Neben den Ergebnissen der Laboranalysen wird für<br />
hydrochemische Modellrechnungen (beispie1sweise<br />
mit PHREEQE) eine (in sich konsistente) thermodynamische<br />
Datenbank benõtigt. Eine derartige<br />
Datenbank enthã1t eine Reihe von Konstanten und<br />
Koeffizienten für die Berechnung der Gleichgewichtszustãnde<br />
in der Lõsung. A1s Beispiele seien<br />
die Gleichgewichtskonstanten für die verschiedenen<br />
Ionen, die Parameter für die Gleichungen der Aktivitãtskoeffizienten<br />
oder die Reaktionsenthalpien<br />
genannt.<br />
Für die Auswertung der hydrochemischen Analysen<br />
der <strong>Nagra</strong> wurde eigens eine thermodynamische<br />
Datenbank zusammengestellt. Die entsprechenden<br />
Werte sind zusammen mit Anmerkungen und Literaturzitaten<br />
in PEARSON et al. (NTB 86-19, Anhang)<br />
publiziert. Die Datenbank ist vollstãndig im Hinblick<br />
auf a1Ie wichtigen Inhaltsstoffe.<br />
Von den Mineralphasen wurden bisher nur diejenigen<br />
implementiert, für die zuver1ãssige thermodynamische<br />
Werte verfügbar sind. Im einzelnen ist dies<br />
für folgende Minerale der FalI: Calcit, Dolomit,<br />
Gips, Anhydrit, Baryt, Cõlestin, Quarz, Chalcedon,<br />
verschiedene Eisenoxide und Hydroxide sowie Uraninit.<br />
Komplexere Minerale, wie zum Beispiel<br />
Schichtsilikate, feh1en noch võllig.<br />
Wie in PEARSON (NTB 85-05) diskutiert, wird der<br />
Eisengehalt der Wasserproben durch die Probennahme<br />
verfã1scht (Einfluss der Verrohrung, des Gestãnges,<br />
der Steig1eitung etc.). Aus diesem Grunde<br />
wurde bei den Modellrechnungen auf eine Mitberücksichtigung<br />
der eis en- und manganhaltigen Minerale<br />
verzichtet.<br />
Trotz der erwãhnten Lücken kann mit dem hydrochemischen<br />
Modell die Widerspruchsfreiheit der<br />
Karbonatgeha1te und des gemessenen pH-Wertes<br />
mit der Menge an gelõstem Koh1endioxid überprüft<br />
werden. Ferner kann die Übereinstimmung der verschiedenen<br />
Indikatoren für das Redoxpotentia1 untersucht<br />
werden. Ausserdem ist das Programm in<br />
der Lage, die Sãttigungsindices für verschiedene<br />
Minera1e und die Partia1drucke der vorkommenden<br />
Gase zu berechnen. Zusãtz1ich kõnnen Mischungsund<br />
Lõsungsvorgãnge simuliert werden.<br />
Die folgenden Kapitel demonstrieren einige Anwendungsmõg1ichkeiten<br />
von hydrochemischen Modellrechnungen.<br />
9.5.2.4 Karbonat-System und pH-Wert<br />
Das Karbonat-System wird im al1gemeinen durch das<br />
Kalk-Kohlensãure-Gleichgewicht charakterisiert.<br />
Eine Zusammenstellung der massgeblichen Gleichungen<br />
ist in PEARSON (NTB 85-05: Kap.4.2.1)<br />
entha1ten. Eine allgemeinere Diskussion fmdet sich<br />
auch in der einschlãgigen Literatur (z.B. HOEL<br />
TING, 1980).<br />
Die korrekte Bestimmung des Karbonat -Systems ist<br />
schwierig, da das Kalk-Koh1ensãure-Gleichgewicht<br />
sehr empfmd1ich auf Druck- und Temperaturãnderungen<br />
reagiert, die wabrend der Probennahme