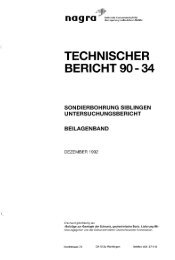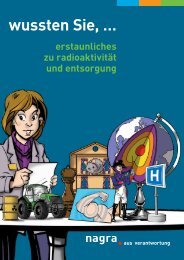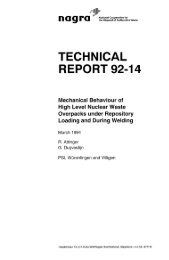Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-117 -<br />
Normalerweise ist der hydrostatische Druck im<br />
Bohrloch stets etwas grõsser als jener in der Formation,<br />
sodass durch den Aufbau eines Filterkuchens<br />
eine Strõmung vom oder zum Bohrloch verhindert<br />
wird. Auf diese Weise soll z.B. ein Blowout bzw.<br />
Spülungsverluste vermieden werden. Die besonderen<br />
Umstãnde im Kristallin (geringe Zuflussmengen etc.)<br />
erlaubten es, ab 2'067 m deionisiertes Wasser mit<br />
einem spezifischen Gewicht von 1.00 g/cm 3 als<br />
"Bohrspü1ung" zu verwenden. Durch Aufmineralisierung<br />
im Bohrloch sank der Spülungswiderstand<br />
dabei auf ca. 5 Om ab.<br />
Abgesehen von den allgemeinen Schwierigkeiten einer<br />
SP-Interpretation kommt ein nicht abschãtzbarer<br />
Einf1uss durch den schwankenden Widerstand der<br />
Spülung im Beobachtungsbereich (Beil. 8.12) hinzu.<br />
Dies geht auf Zuflüsse aus dem Gebirge zurück,<br />
wobei Wasser mit einem durchschnittlichen Widerstand<br />
von 0.25 Om ins Bohrloch strõmte. Diese<br />
Werte beziehen sich auf die jeweils in dieser Tiefe<br />
herrschenden Temperaturen (ca. 100°C).<br />
Wãhrend positive SP-Anomalien keine besonderen<br />
Merkmale hinsicht1ich einer Korrelation mit anderen<br />
Logs aufweisen, sind bei den negativen doch gewisse<br />
Trends festzustellen.Im vorliegenden Fall fãllt auf,<br />
dass einige der negativen Anomalien bspw. bei<br />
2'336 m, 2'379 m, 2'392 m und 2'422 m mit Aplitgãngen<br />
(Beil. 6.27) zusammenfallen, wobei das Maximum<br />
meistens an der Kontaktflãche zum Gneis ausgebildet<br />
ist. Dies ist wohl darauf zurückzuführen,<br />
dass die Aplite einen sehr hohen Widerstand aufweisen<br />
und dadurch kein Strom fliessen kann. Die Anomalien<br />
im Aplit bei 2'449 m und 2'454 m weichen<br />
davon ab, doch zeigen die anderen Logs keine offensichtlichen<br />
Verãnderungen, um dies zu erklãren.<br />
Kataklasite und stark umgewandelte Gneise (bspw.<br />
bei 2'140 m, 2'268 m sowie bei 2'097 m) treten im SP<br />
ebenfalls z.T. als ausgeprãgte negative Ausschlãge<br />
hervor, doch zeigen lange nicht a1le Scher- und<br />
Umwandlungszonen auch signifIkante Eigenpotentialanomalien.<br />
Die Auswertung der zur selben Zeit durchgeführten<br />
AMS-Messung lãsst Zuflüsse bei 2'076 m, 2'221 m,<br />
2'268 m, 2'357 m und weniger ausgeprãgt bei ca.<br />
2'422 sowie 2'450 m erkennen (Beil. 8.12). Bis auf<br />
jenen bei 2'076 m ist auch stets ein negativer Peak<br />
auf der SP-Spur ersichtlich, dessen Ausschlag jedoch<br />
nicht quantitativ zu erfassen ist. Da die durch die<br />
Zuflüsse verursachten Ãnderungen des Spü1ungswiderstandes<br />
sehr flach verlaufen, ist nicht sicher, ob<br />
der tiefste erkennbare Zufluss mit dem negativen<br />
Peak bei 2'449 m oder mit dem positiven bei 2'452 m<br />
korreliert, wobei ersteres vermutet wird. Der Zufluss<br />
bei 2'066 m zeigt eine abrupte Ãnderung des Spülungswiderstandes<br />
und ist mõglicherweise auf eine<br />
Stõrung der AMS-Messung zurückzuführen. Der negative<br />
Peak des SP kann zur Beurteilung nicht mehr<br />
herangezogen werden, da das Log durch den nahen<br />
Rohrschuh beeinflusst ist.<br />
Trotzdem die Zuflussstellen bekannt sind, fehlt es<br />
doch an Erfahrungswerten, wie eine solche Konstellation<br />
das SP beeinf1usst. Es scheint eher unwahrscheinlich,<br />
dass aus dem SP ganz allgemein zuverlãssige<br />
Rückschlüsse über Zuflussstellen gewonnen<br />
werden kõnnen.<br />
Kaliber (Cl-3, C2-4)<br />
Das Kristallin zeigt zwischen 2'020 m (Top) bis<br />
2'065 m ein masshaltiges Bohrloch (12 1/4"). Die gute<br />
Übereinstimmung der Werte der senkrecht zueinander<br />
stehenden Armpaare CI-3 und C2-4 belegt einen<br />
praktisch kreisfõrmigen Querschnitt.<br />
Unterhalb der bei 2'065 m abgesetzten Verrohrung<br />
ist das Bohrloch bis 2'130 m stark erweitert und zeigt<br />
überwiegend eine ovale Form mit einem Durchmesser<br />
von bis zu 16", anstelle der gebohrten 8 1/2". Da<br />
kein Gesteinswechsel vorliegt, dürfte dies bohrtechnisch<br />
bedingt sein.<br />
Zwischen 2'130 m und 2'230 m ist das Bohrloch bei<br />
einem Kaliber von 6 7/32" nur wenig ausgeweitet und<br />
bis zur Endteufe von 2'482 m masshaltig, was ein<br />
Indiz für eine g1atte Bohrlochwandung ist. Einige der<br />
Bohrlochwandausbrüche (z.B. bei 2'041 m, 2'075 m)<br />
sind an Katak1asite gebunden, doch lãsst sich keine<br />
strenge Korrelation zwischen dem am Kern bestimmten<br />
Kataklasierungsgrad und dem Kaliber feststellen.<br />
Aus der statistischen Gesamtana1yse der Bohrlochwandausbrüche<br />
lãsst sich eine generelle, wenn auch<br />
geringe Asymetrie des Bohrlochquerschnitts, mit<br />
einem entsprechenden Ausbruchsazimut von ca. 40<br />
Grad ermitteln (Kap. 6.5.5).<br />
Elektrische Widerstãnde (RLLD, RLLS, RMSFL)<br />
Die RLLD-Spur (grosse Eindringtiefe) und RLLS<br />
Spur (mitt1ere Eindringtiefe) zeigen im vorliegenden<br />
Falle fast identische Widerstãnde, jedoch mit deutlichen<br />
Schwankungen über mehrere Dekaden. Die<br />
RMSFL-Spur, welche die geringste Eindringtiefe<br />
besitzt, erreicht aufgrund des unterschiedlichen