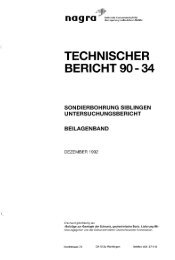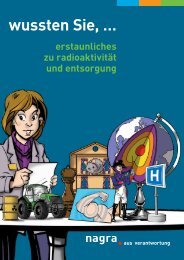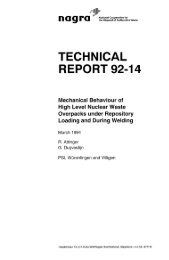Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-107 -<br />
meisten Prehnite sind sehr eisenreich mit Fe1:oJFe1:01:<br />
+ Alvx_ Verhã1tnissen von 0.15-0.35.<br />
Pumpellyit, ein komplexes Inselsilikat, findet sich<br />
zwischen 2'090-2'133 m Teufe als xenomorphe Hãufchen<br />
in Kataklasiten und Biotiten, seltener als feinste<br />
stengelig-prismatische Kristãllchen in Quarzklüftchen.<br />
Die Pumpellyite sind, analog den Prehniten,<br />
ziemlich eisenreich und zeigen z.T. einen deutlichen<br />
Ersatz des Calciums durch Magnesium.<br />
Epidot/K1inozoisit ist selten und ist nur unterhalb<br />
2'140 m Teufe vorhanden. Er bildet meist kleine,<br />
xenomorphe Kõrner oder Linsen im Biotit. Als Ausnahme<br />
wurden in einem "Typ l"-umgewandelten<br />
Gneis bei 2'283 m auch 1-2 mm grosse, zonare und<br />
idiomorphe Kristalle beobachtet.<br />
Calcit tritt meist in Zusammenhang mit den postkataklastischen<br />
Klüftungen als derbe Kluftfüllungen,<br />
als schichtparallele Linsen in Biotiten und als xenomorphe<br />
Massen in Plagioklasen und umgewandelten<br />
Hornblenden auf. Im obersten Kristallin wird die<br />
Plagioklas-Vertonung von Calcitausfãllungen begleitet.<br />
Es handelt sich um reines CaC0 3 , Siderit wurde<br />
nicht beobachtet.<br />
Fluorit wurde nur innerhalb des Gangkomplexes<br />
angetroffen, in Form (OOl)-paralleIer Linsen in<br />
umgewandeIten Biotiten. Die Bildung solcher FIuoritlinsen<br />
bei der U mwandlung primãr fluorhaltiger<br />
Biotite ist weit verbreitet und wurde zum Beispiel<br />
auch im Bõttstein- und im Leuggern-Granit beobachtet.<br />
Die Biotite der Weiacher Gneise dagegen<br />
weisen auch bei stãrkster Umwandlung nie Fluoritlinsen<br />
auf und dürften daher weitgehend fluorfrei<br />
sein. Dasselbe gilt auch für die Aplite und Pegmatite.<br />
Dies untermauert die Hypothese, wonach diese<br />
Ganggesteine lokalen, metamorphen Ursprungs sind,<br />
der aplitische Gangkomplex von 2'228-2'262 m Teufe<br />
jedoch ganz anderer Herkunft ist und evt. von einem<br />
oberkarbonischen Granitpluton ausging.<br />
Apophyllit (K C~ [Sk010]2)(OH,F)s H20) wurde<br />
nur gerade im Bereiche um 2'095 m als Drusenfüllung<br />
in vollstãndig "Typ l"-umgewandelten Gesteinen<br />
angetroffen.<br />
Im Titanit wird das bei der Biotit - und Hornblende<br />
Umwandlung freiwerdende Ti gebunden. Nur selten,<br />
in "Typ l"-umgewandelten Gneisen, bildet er idiomorphe<br />
Kristalle. Es handelt sich um ziemlich<br />
Al-reiche Titanite mit A1I(Al + Ti)-Verhãltnissen von<br />
0.1-0.2.<br />
Bei der "Typ 2"-Umwandlung bildete sich neben<br />
Titanit hãufig auch Rutil/Anatas, meist in kurzprismatischer,<br />
seltener auch in sagenitischer Ausbildung.<br />
Pyrit wurde nicht in bedeutender Menge gebildet. Er<br />
kommt meist als Mikrorissfüllung oder in Calcitklüften<br />
vor.<br />
Hãmatit erscheint im obersten Kristallin, zwischen<br />
ca. 2'025-2'070 m. Er bildet im Biotit parallel zu<br />
(001) eingelagerte Einzelkristalle oder Aggregate<br />
von oft perfekt hexagonalem, rot durchscheinendem<br />
Habitus. Die Rotfãrbung der Plagioklase im obersten<br />
Teil dürfte ebenfalls auf Hãmatitplãttchen zurückzuführen<br />
sein.<br />
6.6.5 Flüssigkeitseinschlüsse<br />
6.6.5.1 A1lgemeine Bemerkungen<br />
Studien an Flüssigkeitseinschlüssen kõnnen vielfãltige<br />
Informationen über die Art der Fluids bei tektonischen<br />
Ereignissen oder bei Mineralneubildungen<br />
sowie über Temperatur- und Druckbedingungen<br />
beim Einschliessungsprozess liefern.<br />
Die Untersuchung der Fluideinschlüsse wurde mit<br />
der Methode der Mikrothermometrie durchgeführt.<br />
Dabei wird ein Durchlichtmikroskop benützt, das<br />
mit einer Heiz- und Kühlanlage ausgerüstet ist. Mit<br />
ihr werden die Phasenübergãnge innerhaIb der Flüssigkeitseinschlüsse<br />
im Temperaturbereich zwischen<br />
-180° und 600°C beobachtet und gemessen (ROED<br />
DER, 1962/1963; POTY et al., 1976).<br />
In der Bohrung Weiach wurden einerseits Einschlüsse<br />
in Gesteins-, Kluft- und Drusenquarzen des<br />
Buntsandsteins, Permokarbons und des Kristallins<br />
und andererseits Einschlüsse in Kluftcalciten des<br />
Malms und der Unteren Süsswassermolasse untersucht.<br />
Die Resultate aus dem Kristallin und aus den<br />
Sedimenten werden hier, der besseren Verstãndlichkeit<br />
wegen, gemeinsam vorgestellt und diskutiert.<br />
Die Resultate sind in Beilage 6.12 in zwei T s/Ta :<br />
Diagrammen dargestellt.<br />
6.6.5.2 Ergebnisse und Interpretation<br />
Die beobachteten Fluideinschlüsse der Bohrung<br />
Weiach, wie auch die der übrigen <strong>Nagra</strong>-Bohrungen<br />
(MULLIS, 1987) Iassen sich in zwei Gruppen unterteilen.<br />
Bei den in Quarzen beobachteten Einschlüssen<br />
handeIt es sich ausschliesslich um zweiphasige,<br />
sekundãre Einschlüsse, die auf verheilten Bruchflã-