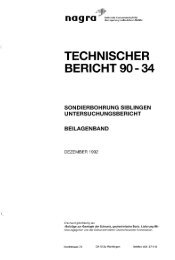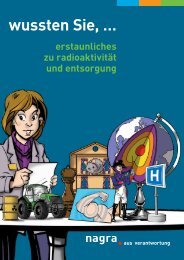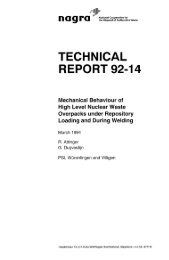Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Deutsch (27.2 MB) - Nagra
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-132 -<br />
den. Im Labor durchgeführte Dichtebestimmungen<br />
bestãtigen die Werte des LDT -Logs, welches für die<br />
Ganggesteine eine durchschnittliche Dichte von 2.61<br />
g/cm 3 anzeigt.<br />
Die Interpretation der vorliegenden Dichtewerte<br />
würde für diesen Gangkomplex eine steile Lagerung<br />
aufzeigen, welche das Gravimeter aufgrund des steilen<br />
Einfallswinkels wenig, das LDT-Tool aber zu<br />
100% beeinflusste (vgl. NTB· 85-01: Beil. 6.33). Die<br />
etwas geringere Dichte der Gneise unterhalb des<br />
Gangkomplexes im Vergleich zu denen oberhalb<br />
desselben dürfte im Zusammenhang mit den hier in<br />
der Bohrung hãufigeren sauren Gãngen stehen. Diese<br />
sind mãglicherweise Teil eines lãngs steilstehender<br />
Spalten und Klüfte aufgedrungenen, vernetzten<br />
Gangschwarmes.<br />
Die Kernaufnahmen zeigen, dass in einigen Abschnitten<br />
die gut unterscheidbaren, hellen Aplite nur<br />
in einer Kernhãlfte vorhanden sind, d.h. quasi parallei<br />
zur Bohrung verlaufen und von dieser nur zum<br />
Teil erfasst Wurden. Welche Gesteinsdichte in einem<br />
solchen Fall mit dem LDT -Gerãt erfasst wird - die<br />
des Aplites oder die des Gneises - hãngt ausschliesslich<br />
von der Orientierung des Messschlittens ab. Da<br />
das Bohrlochgravimeter in diesem FalI einen weit<br />
grõsseren Bereich integriert, ergeben sich hier<br />
zwangslãufig Differenzen zwischen den BHGM- und<br />
den LDT -Dichten.<br />
7.3 GEOTHERMIE<br />
7.3.1 Auswertungsziele<br />
Bei der Ermittlung der Temperaturverteilung im<br />
Untergrund ist man weitgehend auf direkte Messungen<br />
angewiesen. Bei Tietbohrungen besteht prinzipiell<br />
die Mãglichkeit, Temperaturmessungen in verschiedenen<br />
Tiefen durchzuführen. Allerdings wird<br />
die Gesteinstemperatur durch den Bohrvorgang z.T.<br />
erheblich gestõrt. Insbesondere macht sich das Vorhandensein<br />
bzw. die Zirkulation der Bohrspü1ung<br />
bemerkbar. Dies ist von einiger Bedeutung, weil im<br />
Bohrloch nur die Temperatur der Spülung, nicht<br />
aber diejenige des umgebenden Gesteins gemessen<br />
werden kann. Die in die Formation verpresste Spülung<br />
wird sich wãhrend einer gewissen Zeit ebenfalls<br />
stõrend auswirken.<br />
Zur Eliminierung dieser vom Bohrvortrieb bzw. von<br />
der Spü1ungsbewegung herrührenden Stõreffekte<br />
existiert eine umfangreiche Literatur.<br />
7.3.2 Ausgangsdaten<br />
In Tiefbohrungen kõnnen verschiedene Rohdaten<br />
gewonnen werden, welche Informationen über die<br />
Gesteinstemperatur enthalten:<br />
- punktuelle Temperaturmessungen an der Bohrlochsohle<br />
(BHT -Werte / "Bottom Hole Temperature").<br />
Mehrere zeitlich gestaffelte Messungen<br />
pro Sohlentiefe.<br />
- Kontinuierliche Aufzeichnung der Spü1ungstemperatur<br />
entlang des Bohrlochs (HRT -, AMS-,<br />
PTL-Logs, Fluid-Logging)<br />
- Temperaturmessungen in abgepackerten Inte1Vallen,<br />
die wãhrend hydraulischen Formationstests<br />
ausgeführt werden.<br />
Die im jeweiligen Bohrlochtiefsten gemessenen<br />
BHT-Temperaturen nãhern sich, nach abgestellter<br />
Spülungszirkulation, nur allmãhlich der Gesteinstemperatur.<br />
Neben den Temperaturwerten müssen dabei<br />
noch folgende Grõssen festgehalten werden:<br />
erreichte Tiefe (m)<br />
- Bohrlochdurchmesser (m)<br />
- Ende des Bohrens (Tag/Stunde/Minute)<br />
- Bohrzeit für den letzten Meter (Minuten)<br />
- Ende der Spü1ungszirkulation (Tag/Stunde/<br />
Minute)<br />
- Art und spezifisches Gewicht der Spülung<br />
(kg/m 3 )<br />
- Beginn des Sondenwiederaufstiegs (Tag/Stunde/<br />
Minute)<br />
Im alIgemeinen erfolgt die Temperaturmessung mit<br />
Maximum-Thermometern (Mitführen von zwei Thermometern<br />
bei jeder Bohrlochsonde, Mittelwertbildung;<br />
Messgenauigkeit rund ± rc). Gestützt auf<br />
die obigen Daten lãsst sich, aufgrund von speziell<br />
entwickelten Extrapolationsverfahren, die wahre<br />
Formationstemperatur mit einer Genauigkeit von 5-<br />
10% bzw. ± 2°C angeben. Auf diese Weise enthãlt<br />
man ein allerdings lediglich durch wenige Einzelpunkte<br />
defmiertes Temperatur-Tiefenprofil.<br />
Die kontinuierlichen Logs der Spülungstemperatur<br />
geben die Verteilung der wahren Formationstemperatur<br />
entlang der Bohrlochachse ebenfalls meist nur<br />
annãherungsweise wieder. Nach Abstellen der Zirkulation<br />
ist die Spü1ung nãmlich oft in natürlicher<br />
Bewegung (Wasserein- und -austritte, Konvektionsbewegungen,<br />
artesischer Aufstieg). Dies stõrt den<br />
Temperaturausgleich zwischen Spü1ung und Formation<br />
und erschwert unter Umstãnden die Ermittlung