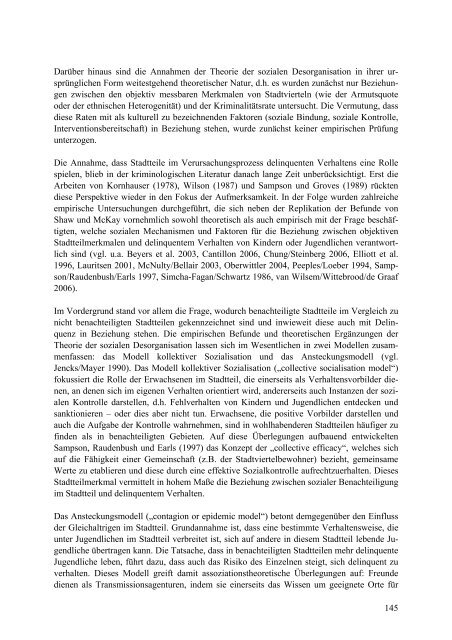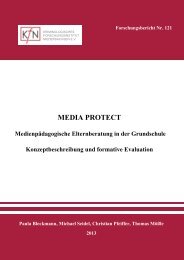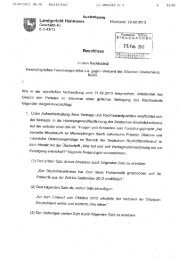Jugendgewalt und Jugenddelinquenz in Hannover. Aktuelle Befund
Jugendgewalt und Jugenddelinquenz in Hannover. Aktuelle Befund
Jugendgewalt und Jugenddelinquenz in Hannover. Aktuelle Befund
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Darüber h<strong>in</strong>aus s<strong>in</strong>d die Annahmen der Theorie der sozialen Desorganisation <strong>in</strong> ihrer ursprünglichen<br />
Form weitestgehend theoretischer Natur, d.h. es wurden zunächst nur Beziehungen<br />
zwischen den objektiv messbaren Merkmalen von Stadtvierteln (wie der Armutsquote<br />
oder der ethnischen Heterogenität) <strong>und</strong> der Krim<strong>in</strong>alitätsrate untersucht. Die Vermutung, dass<br />
diese Raten mit als kulturell zu bezeichnenden Faktoren (soziale B<strong>in</strong>dung, soziale Kontrolle,<br />
Interventionsbereitschaft) <strong>in</strong> Beziehung stehen, wurde zunächst ke<strong>in</strong>er empirischen Prüfung<br />
unterzogen.<br />
Die Annahme, dass Stadtteile im Verursachungsprozess del<strong>in</strong>quenten Verhaltens e<strong>in</strong>e Rolle<br />
spielen, blieb <strong>in</strong> der krim<strong>in</strong>ologischen Literatur danach lange Zeit unberücksichtigt. Erst die<br />
Arbeiten von Kornhauser (1978), Wilson (1987) <strong>und</strong> Sampson <strong>und</strong> Groves (1989) rückten<br />
diese Perspektive wieder <strong>in</strong> den Fokus der Aufmerksamkeit. In der Folge wurden zahlreiche<br />
empirische Untersuchungen durchgeführt, die sich neben der Replikation der Bef<strong>und</strong>e von<br />
Shaw <strong>und</strong> McKay vornehmlich sowohl theoretisch als auch empirisch mit der Frage beschäftigten,<br />
welche sozialen Mechanismen <strong>und</strong> Faktoren für die Beziehung zwischen objektiven<br />
Stadtteilmerkmalen <strong>und</strong> del<strong>in</strong>quentem Verhalten von K<strong>in</strong>dern oder Jugendlichen verantwortlich<br />
s<strong>in</strong>d (vgl. u.a. Beyers et al. 2003, Cantillon 2006, Chung/Ste<strong>in</strong>berg 2006, Elliott et al.<br />
1996, Lauritsen 2001, McNulty/Bellair 2003, Oberwittler 2004, Peeples/Loeber 1994, Sampson/Raudenbush/Earls<br />
1997, Simcha-Fagan/Schwartz 1986, van Wilsem/Wittebrood/de Graaf<br />
2006).<br />
Im Vordergr<strong>und</strong> stand vor allem die Frage, wodurch benachteiligte Stadtteile im Vergleich zu<br />
nicht benachteiligten Stadtteilen gekennzeichnet s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> <strong>in</strong>wieweit diese auch mit Del<strong>in</strong>quenz<br />
<strong>in</strong> Beziehung stehen. Die empirischen Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> theoretischen Ergänzungen der<br />
Theorie der sozialen Desorganisation lassen sich im Wesentlichen <strong>in</strong> zwei Modellen zusammenfassen:<br />
das Modell kollektiver Sozialisation <strong>und</strong> das Ansteckungsmodell (vgl.<br />
Jencks/Mayer 1990). Das Modell kollektiver Sozialisation („collective socialisation model“)<br />
fokussiert die Rolle der Erwachsenen im Stadtteil, die e<strong>in</strong>erseits als Verhaltensvorbilder dienen,<br />
an denen sich im eigenen Verhalten orientiert wird, andererseits auch Instanzen der sozialen<br />
Kontrolle darstellen, d.h. Fehlverhalten von K<strong>in</strong>dern <strong>und</strong> Jugendlichen entdecken <strong>und</strong><br />
sanktionieren – oder dies aber nicht tun. Erwachsene, die positive Vorbilder darstellen <strong>und</strong><br />
auch die Aufgabe der Kontrolle wahrnehmen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> wohlhabenderen Stadtteilen häufiger zu<br />
f<strong>in</strong>den als <strong>in</strong> benachteiligten Gebieten. Auf diese Überlegungen aufbauend entwickelten<br />
Sampson, Raudenbush <strong>und</strong> Earls (1997) das Konzept der „collective efficacy“, welches sich<br />
auf die Fähigkeit e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaft (z.B. der Stadtviertelbewohner) bezieht, geme<strong>in</strong>same<br />
Werte zu etablieren <strong>und</strong> diese durch e<strong>in</strong>e effektive Sozialkontrolle aufrechtzuerhalten. Dieses<br />
Stadtteilmerkmal vermittelt <strong>in</strong> hohem Maße die Beziehung zwischen sozialer Benachteiligung<br />
im Stadtteil <strong>und</strong> del<strong>in</strong>quentem Verhalten.<br />
Das Ansteckungsmodell („contagion or epidemic model“) betont demgegenüber den E<strong>in</strong>fluss<br />
der Gleichaltrigen im Stadtteil. Gr<strong>und</strong>annahme ist, dass e<strong>in</strong>e bestimmte Verhaltensweise, die<br />
unter Jugendlichen im Stadtteil verbreitet ist, sich auf andere <strong>in</strong> diesem Stadtteil lebende Jugendliche<br />
übertragen kann. Die Tatsache, dass <strong>in</strong> benachteiligten Stadtteilen mehr del<strong>in</strong>quente<br />
Jugendliche leben, führt dazu, dass auch das Risiko des E<strong>in</strong>zelnen steigt, sich del<strong>in</strong>quent zu<br />
verhalten. Dieses Modell greift damit assoziationstheoretische Überlegungen auf: Fre<strong>und</strong>e<br />
dienen als Transmissionsagenturen, <strong>in</strong>dem sie e<strong>in</strong>erseits das Wissen um geeignete Orte für<br />
145